
Aus dem
Nachlaß herausgegeben von
SIEGFRIED BEHN
Privatdozent der Philosophie an der Universität Bonn

Verlag von S. Hirzel in Leipzig / 1921
III
Oswald Külpes hinterlassene Aufzeichnungen zur Ästhetik sind von mir nach denselben Grundsätzen herausgegeben worden, die schon Bühler bei seiner Veröffentlichung der Vorlesung über Psychologie ausgesprochen hat. Die Blätter zur Ästhetik fanden sich nicht in einem Zustande, der es erlaubt hätte, einfach einen zusammenhängenden, in sich geschlossenen, und gleichmäßig durchgearbeiteten Text (natürlich mit Sorgfalt durchgesehen) dem Druck zu überliefern. Manche Teile des ästhetischen Werkes, insonderheit die Kunstästhetik, waren kaum über die Anlage hinaus und so ungleichmäßig ausgeführt, daß es keinesfalls im Sinne Külpischer Sorgsamkeit gehandelt wäre, sie der wissenschaftlichen Welt vorzulegen. Zweifellos waren all diese Niederschriften, auch die verschiedenen Schichten von Vorlesungsunterlagen, als Vorarbeiten zu einem Buch gedacht. Die von Külpe durchgearbeiteten Blätter sind im Stil des geschriebenen, nicht des gesprochenen Wortes gehalten. Auch galt es, so viel an Bruchstücken in Aufsatzform einzupassen, daß es gezwungen wirken würde, alles, was an Gedanken wertvoll ist, in „Vorlesungen“ gegliedert darzubieten. Hierin unterscheidet sich der Nachlaß zur Ästhetik von den Aufzeichnungen zur Psychologie. Wiederum aber habe ich Bedenken getragen, die von mir behutsam zum Buch zusammengefaßten Seiten einfach mit „Ästhetik“ zu überschreiben. Das hätte zu leicht den Eindruck erweckt, als ob Külpe wenigstens den allgemeinen Teil seines ästhetischen Lebenswerks schon abgeschlossen niedergelegt hinterlassen hätte. Und in Wahrheit kann es doch keinem, der sich aus genauerer Kenntnis des verehrten Mannes heraus um die Papiere zur Ästhetik müht, verborgen
IV
bleiben, wie sehr da noch alles auf durchgreifende Weiterarbeit hin angelegt war. Daß nur Külpe uns diese hätte schenken können, ist selbstverständlich. Gerade die Entwürfe aus der allerletzten, der Münchner Zeit (durch Inhalt und Schriftgebung schon als solche mit Sicherheit kenntlich), weisen eine beginnende Wandlung und Bereicherung der Ansicht auf. Deshalb habe ich die Buchüberschrift „Grundlagen der Ästhetik“ vorgezogen. Überhaupt sieht teilnehmendes Verständnis den Denker und Forscher Külpe von der ersten bis zur letzten Niederschrift in unbefangener, stet reifender Entwicklung. Ich habe es nicht für meine Aufgabe gehalten, hier zu ebnen, den feinen Duft des Wachstums und der Entfaltung auszutreiben, den als intimen Reiz diese Lebensarbeit ausatmet. Das schließt nicht aus, daß ich wie Bühler kleine Unstimmigkeiten ausglich, gelegentlich Stichworte zu Sätzen formte. Viele Darlegungen fanden sich in mehreren Fassungen (bis zu fünf) ausgeführt; dann habe ich die reichste und reifste gewählt, die meist, aber nicht immer, die spätere ist. Gelegentlich hat sich nämlich Külpe früher Ausgeführtes nochmals skizzenhaft angemerkt, manchmal wohl zu Einzelanlässen, die jetzt nicht mehr zu erraten sind. Besonders wertvolle Gedanken oder Formungen früherer Fassung sind immer gerettet worden. Stilistisch hat Külpe verschiedene Schichten und verschiedene Kapitel mit sehr ungleich verteilter Liebe durchgearbeitet. Hier konnte mit Vorsicht ein gewisser Ausgleich geschaffen werden, weil Külpe breite Teile seiner Ästhetik in einem sorgfältigen Vortragsentwurf (in einer Paralleldarstellung) zusammengefaßt hat. Maßgebend waren mir hier jene wohlausgebauten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1914, die im Nachlaß als „Londoner Vortrag“ vorkommen. Aus sehr begreiflichen Gründen ist dieser Vortrag (zu dem schon englische Notizen angefangen waren) niemals gehalten worden. Ihn einfach wörtlich abzudrucken, ging nicht an, weil der Sinnzusammenhang der übrigen Darstellung doch reicher ist. Es wären dann neben dieser Fassung unlesbare Bruchstücke in zer-
V
splitterter Menge übriggeblieben. Stilvorbild aber ist diese späteste durchgeführte Niederschrift geblieben. Sie gilt dem Thema, das Külpe mit am meisten beschäftigt hat: Ästhetik und Psychologie. Seit Külpe dieser Frage Antwort gesucht hat, ist er von einseitiger Auffassung zu immer umspannenderem Weitblick fortgeschritten. Wo die spätere und weitherzigere Darstellung in unlösbarem Widerspruch zu den allerfrühesten Niederschriften steht, habe ich nur der reiferen Meinung Raum gegeben. Ebenso haben manche Schärfen absprechender Kritik weichen müssen, die nur von dem aufgegebenen Standpunkt aus gerechtfertigt erscheinen. Außer dem sog. Londoner Vortrag enthält der Nachlaß die Handschrift zu einem Aufsatz über die Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. Er ist gedruckt in der Festschrift: Philosophische Abhandlungen, Max Heinze zum 70. Geburtstage gewidmet. S. 101-127. Berlin 1906. Baeumkers bibliographische Übersicht (vgl. S. 190) nennt diesen Aufsatz nicht. Es folgen außer sonstigen veröffentlichten Handschriften Stöße von Auszügen aus namhaften Ästhetikern der Gegenwart mit kritischen Bemerkungen, die insgesamt zum Handwerkszeug zu rechnen sind. Sie legen Zeugnis ab von Külpes rastlosem und gewissenhaftem Fleiß. Auch Briefe, z. B. von Lange und Bullough, hat Külpe unter seinen Aufzeichnungen verwahrt, selbst die Notizen zu Seminarübungen. All dies Material konnte dazu helfen, mir das Verständnis von Külpes Entwicklungsgang zu vertiefen. Als eigentlicher Grundtext zur Herausgabe dienten die Vorlesungsunterlagen und Niederschriften zur Geschichte der Ästhetik und zur systematischen Ästhetik selbst. Die Aufzeichnungen zur Geschichte verlieren nach Darstellung der englischen Ästhetik rasch an Ausführlichkeit und Eindringlichkeit; sie verlieren mit Külpes innerer Anteilnahme und sinken bald bis zu bloßen Verzeichnissen von Denkern und Werken herab. Diese Abschnitte durften um so getroster von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, als Külpe selbst mit ausdrücklichen
VI
Worten an die Engländer einerseits und an Fechner anderseits unmittelbar anknüpft. Die Literaturangaben zu den einzelnen Abschnitten nennen Werke, die auf Külpe von Einfluß gewesen sind, mit denen er sich eingehend auseinandergesetzt hat oder die unter seiner Einwirkung entstanden sind. Außer den nachgelassenen Papieren habe ich noch ein vollständiges Kollegheft, das in Külpes Bonner Zeit fleißig und sorgsam nachgeschrieben worden ist, durchweg verglichen. Es hat der Arbeit vielleicht hie und da genützt, daß es mir vergönnt war, in vertrautem Gespräch mit dem teuren Manne etwas von dem Tonfall zu erlauschen, in dem er von Dingen der Ästhetik zu reden liebte.
September 1921.
Der Herausgeber.
Ein merkwürdiges Geschick ruht auf der Ästhetik. Ihr Gegenstand ist so bekannt und geschätzt, wie kaum ein zweiter. Sie selbst aber ist so unbeliebt, wie kaum eine andere Wissenschaft.
Die hingebende Betrachtung eines Kunstwerkes gehört zu den deutlichsten, tiefsten und selbständigsten Erlebnissen, die wir kennen. Das ästhetische Verhalten ergreift den ganzen Menschen, ist keine Teilerscheinung neben anderen. Es duldet, während es uns erfaßt, kein Nebeninteresse, keine Nebenbeschäftigung. Technik und Verbreitung von Reproduktionen erlauben heute weiten Kreisen, ästhetische Erfahrung zu sammeln, aber auch die Kunst unserer Tage ist nicht unproduktiv; vielleicht mehr als zuvor wird die Natur von uns gesucht, die erhabene und liebliche, groteske und anmutige Eindrücke spendet. Gewiß gibt es dabei Grade der ästhetischen Empfänglichkeit, und manchem erscheint Freude an schönen Dingen als kaum erlaubter Müßiggang. Andern Personen wiederum steht eine Versenkung in Kunstgenuß und ästhetische Freuden im Vordergrund des Interesses.
Aber solche praktische Betätigung des Geschmackes und die wissenschaftliche Beschäftigung damit sind grundverschieden. Dort ein genießendes Betrachten, das durch Zergliederung und Begründung nicht gestört sein will, in dem Unbeschreibliches Ereignis wird; hier der Versuch, genau und vollständig Rechenschaft zu geben über den Tatbestand des ästhetischen Verhaltens und seine Bedingungen, also eine wissenschaftliche Betätigung. Rechenschaft über den Geschmack wird freilich auch sonst zuweilen gefordert. Man
streitet darüber, was gefalle, die Meinungen stoßen wohl einmal aufeinander. Das Ergebnis der üblichen Ansicht ist bei alledem: de gustibus non est disputandum. Jeder ist sein eigener Maßstab und erkennt keine Norm der ästhetischen Würdigung an, die über seinem Geschmack stünde. Dieser Subjektivismus löst alle Wissenschaft auf. Hätte er recht, so könnte es eine wissenschaftliche Ästhetik überhaupt nicht geben. Diese muß danach streben, Allgemeingültiges zu ermitteln, Begriffe und Regeln aufzustellen, die nicht für diesen oder jenen, sondern überhaupt gelten. Da behaupten nun die Gegner der Ästhetik nicht ohne Grund, die Ästhetik sei von der Erfüllung ihrer Aufgabe noch weit entfernt. Es wird in der Tat heute gekämpft um Prinzipien und um Anwendungen, und diese Diskussion wird lebhaft genug geführt.
Ein zweiter Grund zur Ablehnung besteht darin, daß man sich gerade in ästhetischen Dingen die volle Freiheit des Urteils und des Entwurfs wahren will und befürchtet, von wissenschaftlicher Ästhetik darin beeinträchtigt zu werden. Dies Mißverständnis berührt um so seltsamer, als wir seit Kant wissen, daß die Ästhetik dem ästhetischen Verhalten und der Kunst ihre Regeln entnimmt und sie ihnen nicht a priori vorschreibt. Dann aber bestreitet man den Nutzen der Ästhetik. Was soll sie dem Kunstfreund und dem Künstler, dem Kunsthistoriker und dem Kunsttheoretiker leisten? Sie bedürfen ihrer nicht, so sagt man wohl. Ja, man scheut sich bei dem Ernst und der Not der Gegenwart, von Ästhetik zu reden. Gewiß stehen die Notwendigkeiten des Lebens dem Schmuck und den Zieraten voran, mit denen es unseren Geschmack erfreut und befriedigt. Das alte Wort primum vivere, deinde philosophari (oder wie wir hier sagen müßten: deinde placere), behält seine Richtigkeit. Und es verletzt uns in schweren Zeiten besonders tief, wenn Kleidung und Benehmen die Schlichtheit und Zurückhaltung vermissen lassen, die während eines Kampfes um unser Dasein uns einzig angemessen erscheinen. Jeder hat unter solchen Umständen die selbstverständliche Pflicht, seine eigene Person nicht in
auffälliger Weise hervortreten zu lassen, sondern sich der Sache dienstwillig unterzuordnen. Der Sache unserer geistigen Kultur aber tut es not, daß wir Deutsche den Anspruch auf eine führende Stellung im Reich des Geistes, auf die vorderste Linie im Wettkampf um die höchsten Güter nicht preisgeben. Dann dürfen wir auch heute nicht darauf verzichten, Ästhetik zu treiben; denn das ästhetische und wissenschaftliche Verhalten gehören zu den Grundbedürfnissen eines Kulturmenschen, wie Arbeit und Erholung. Darum bricht sich der künstlerische Genius und die wissenschaftliche Begabung mit demselben Drang ihre Bahn, wie Hunger und Durst. Die Versenkung in ihre Werke wirkt läuternd und reinigend, sie erhebt uns über kleinliche Verwicklungen des Lebens, entzieht uns durch ihre sanfte Beanspruchung der ganzen Persönlichkeit den rohen Begierden und löst die seelischen Kräfte aus dem Banne einseitiger Arbeit und der Starre rücksichtsloser Pflichterfüllung.
Die Wissenschaft vom ästhetischen Verhalten braucht nun freilich nicht alle kultivierten Personen gleichermaßen zu interessieren. Es gibt viele Künstler, die sich mit ihrer Kunst nicht zugleich wissenschaftlich oder überlegsam beschäftigen. Wie sich ein Liebhaber der Natur nicht auch als Naturforscher zu betätigen braucht, so kann auch jemand starken Sinn für ästhetische Erlebnisse haben, ohne sich theoretisch ihre Bedeutung und ihre Bedingungen klarmachen zu müssen, ja ohne die geringste Neigung dazu zu zeigen. Wir finden darum auch, daß nicht die Künstler, sondern die Philosophen die wichtigsten Beiträge zur Ästhetik geliefert haben. Ähnlich steht es ja auch auf anderen Gebieten: die besten Menschenkenner sind nicht auch die hervorragendsten Psychologen.
Das beglückende ästhetische Verhalten ist sich selbst genug und schließt eine gleichzeitige wissenschaftliche Untersuchung aus. Darum darf, wer Ästhetik vorträgt, nicht einfach an das ästhetische Verhalten eines jeden appellieren. Er muß auch einen Trieb zur Erkenntnis dieses Verhaltens vor-
aussetzen. Solcher Trieb ist nicht ebenso ursprünglich, wie die Neigung zu ästhetischem Verhalten, aber immerhin ein starkes und verbreitetes Grundbedürfnis aller derer, die im Streit über den Wert eines Kunstwerkes etwa ihren Geschmack als berechtigt und kultiviert dartun wollen. Damit sind dann Maßstäbe ästhetischen Wertes vorausgesetzt, die auch für andere, bestenfalls für alle gelten sollen. Die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Ästhetik beruht auf der allgemeinen Gültigkeit von Feststellungen über das kunstempfängliche, schönheitgenießende Verhalten. So tritt unwillkürlich zu der allgemeinen menschlichen Neigung, ästhetisch zu genießen und zu schaffen, die Tendenz, zwischen Werten und Unwerten zu unterscheiden, die Anerkennung der Werte zu rechtfertigen. Alle Bildung und Erziehung in ästhetischen Dingen ist nur denkbar, wenn der Geschmack verfeinert und vertieft, das Geschmacksurteil berichtigt und vervollkommnet werden kann. Das aber führt unmittelbar zu einer theoretischen Einsicht in Eigenart und Bedingungen des ästhetischen Verhaltens.
Wenn sich die Künstler vielfach gleichgültig oder ablehnend gegen die Ästhetik äußern, so hat das seinen Grund in der Selbstgewißheit ihres Geschmacks und ihrer Schaffenskraft. Niemand wird sie dessen berauben, niemand sie mit Regeln meistern wollen. Es ist auch nur ein Vorurteil, wenn sie meinen, daß die Ästhetik ihre Schaffenskraft beeinträchtige und hemme. Unsere Auffassung drängt uns, wissenschaftlich das ästhetische Verhalten zu untersuchen. Dieses also setzen wir als Gegenstand der Forschung voraus. Es wird dadurch ebensowenig eingeschränkt, so wenig in Fesseln gelegt, wie das Sprechen durch Philologie und das Wandern durch Muskelphysiologie. Nicht die Wissenschaft ist das Prius, sondern ihr Gegenstand. Dieser wird von ihr nicht erzeugt, sondern vorgefunden. Lange bevor es eine Ästhetik der Dichtkunst gab, sind die homerischen Gesänge entstanden, zu schweigen von einer Ästhetik der Malerei bei den vorgeschichtlichen Menschen, die ihre Höhle mit Zeich-
nungen schmückten. Darum ist die Ästhetik auch genötigt, den Änderungen Rechnung zu tragen, die am kunstempfänglichen, schönheitsdurstigen Verhalten im Laufe der Zeiten hervortreten.
Indem wir uns also wissenschaftlich in das ästhetische Verhalten vertiefen wollen, dürfen wir auch hoffen, wesentlichen und starken Bedürfnissen der Kulturmenschheit zu entsprechen und an unserem Teil dazu beizutragen, Schönheit und Wissenschaft in einer unseren großen Überlieferungen würdigen Form zu pflegen. Deutschland hat im achtzehnten Jahrhundert der Ästhetik den Namen gegeben, den sie jetzt überall trägt. Wir hatten im neunzehnten Jahrhundert die unbestreitbare Führung in der ästhetischen Forschung. Deutschland wirkte entscheidend und bahnbrechend auf den Entwicklungsgang der Ästhetik ein. Wir haben auch in der Gegenwart die wichtigsten systematischen Darstellungen geformt.
Die Aufgabe der Ästhetik (und damit ihr Begriff) wird meist anders bestimmt, als ich es getan habe. Dem Altertum war sie die Wissenschaft vom Schönen, dann auch vom Erhabenen; so definierte man auch noch bis in die neueste Zeit Ästhetik als die Wissenschaft von der Schönheit, wenn man sie auch gelegentlich Philosophie der Kunst benannt hat. Unter dem Schönen, dem Erhabenen, der Kunst versteht man dabei gewisse Objekte: Landschaften, Symphonien, Personen, Gemälde, Bauwerke, Dramen. Wenn wir aber näher zusehen, was die Ästhetik eigentlich über solche Naturdinge und Kunstobjekte lehrt, so merkt man alsbald, daß sie nicht nach ihrer realen Wesenheit behandelt werden, die vom auffassenden, betrachtenden, erkennenden und würdigenden Subjekt unabhängig ist. Sondern sie werden erforscht gerade nur in ihrer Beziehung auf ein solches Subjekt. Die Ästhetik sagt uns nichts über das Wesen der Farben und Töne, über die Gesetze des Raumes und der Zeit, über die eigentliche Beschaffenheit der schönen Dinge und Werke; sie sagt nur, wie solche Objekte auf uns wirken, wenn wir uns in einer gewissen Empfänglichkeit mit ihnen beschäftigen. Schön und häßlich sind keine Eigenschaften der Dinge in Natur und Kunst, die auch dann ihnen zukämen, wenn kein ästhetisch gerichteter Sinn sie erfaßte. Wenn es daher heißt, daß sich die Ästhetik mit dem Schönen und Erhabenen oder mit der Kunst abgäbe, so bedeutet das nur, daß sie gewisse Wirkungen von Objekten untersucht, daß sie bestimmte Erscheinungen daran erforscht, die eintreten, wo die Objekte mit ästhetischer Empfänglichkeit aufgefaßt werden. Ein und der-
selbe Gegenstand kann gänzlich unwirksam bleiben, wenn mein Interesse ihm in anderer Weise zugewendet wird. Die schönste Landschaft übt keinen ästhetischen Zauber auf mich aus, sobald ich sie unter geographischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachte. Die erhabensten Kunstwerke können dem Händler, der damit sein Geschäft machen will, und dem Kunsthistoriker, der ihre Entstehung ergründet, ästhetisch recht gleichgültig sein.
Daraus geht hervor, daß die Grundbedingung für das, was wir schön und häßlich nennen, nicht ein irgendwie geartetes Objekt, sondern ein bestimmtes Verhalten Unsererseits ist. Dieses Resultat ergibt sich auch daraus, daß die Gegenstände des empfänglichen Verhaltens den verschiedensten Reichen entnommen werden. Es gibt keine Objekte in Natur und Kunst, die ein Ästhet nicht werten könnte. Aber kein Gegenstand in Natur und Kunst muß ästhetisch aufgefaßt oder gewürdigt werden; der amusische Mensch geht ungerührt vorüber und gewinnt ihnen nichts ab. Folglich darf man die Ästhetik nicht nach einer bestimmten Art von Objekten abgrenzen wollen. Nichts ist an sich weder schön noch häßlich, erst das empfängliche Verhalten macht es dazu. Es entspricht nur der allgemeinen Tendenz zur Objektivierung, wenn man in den Objekten die spezifischen Grundlagen der ästhetischen Urteile erblickt. Aber auch deren Vergegenwärtigung im Bewußtsein ist für das ästhetische Verhalten nicht charakteristisch. Die bloßen Sinneseindrücke und ihre Wahrnehmung, die bloßen Vorstellungsbilder machen noch nichts zum ästhetischen Gegenstand. Ebensowenig hängt die ästhetische Qualität an der Anschaulichkeit als solcher, wie oft behauptet worden ist. Man kann Kunstwerke wahrnehmen oder sich nur an sie erinnern, man denkt an ein Gemälde, das man gesehen hat, ohne ästhetisch ergriffen zu werden; man kann andererseits im Genuß einer Dichtung manches wissend vergegenwärtigen, was nie zu anschaulichen Vorstellungen entfaltet wird. Nicht also die Sonderart der Objekte und auch nicht jedwede Auffassung
davon, sondern nur ein spezifisch empfängliches Verhalten unsererseits macht erst ästhetische Gegenstände. Damit soll nicht gesagt sein, daß es auf die Beschaffenheit der Objekte überhaupt nicht ankomme. Ein anmutiger Faltenwurf wird auch den Anästheten noch nicht plump anmuten. Besondere Untersuchung wird vielmehr darauf ausgehen, die ästhetischen Wirkungen auch durch gegenständliche Eigentümlichkeiten zu erklären. Aber diese Eigentümlichkeiten haben eine ästhetische Bedeutung überhaupt nur unter der Voraussetzung eines empfänglichen Verhaltens besonders erregbarer Personen. Wenn ich daher die Ästhetik eine Wissenschaft von derart empfänglichem Verhalten nenne, so will ich dessen Objekte in diese Bestimmung miteingeschlossen wissen.
Was kennzeichnet nun dies empfängliche Verhalten? Darauf wäre zunächst zu sagen: eine ungeteilte Beschäftigung mit seinen Gegenständen. Aber ungeteilt beschäftigen wir uns auch, wenn wir etwa einen wissenschaftlichen Versuch anstellen. Die besondere Natur des ästhetischen Verhaltens bestimmt sich durch den Gesichtspunkt, unter dem wir uns mit dem Gegenstande beschäftigen. Einer Landschaft gegenüber verhalten wir uns ästhetisch, wenn wir sie im Zustande der Kontemplation betrachten, wenn wir uns an ihre Formen und Farben hingeben, ohne Interesse für ihre Wälder und Wiesen in ihrer qualitativen Tatsächlichkeit. Überall im Natur- und Kunstgenuß fesselt uns nur die merkliche Beschaffenheit der Objekte, die für das Bewußtsein irgendwie unmittelbar und gegenwärtig vorhanden sind. Dabei scheiden wir nicht etwa zwischen einer objektiv und einer subjektiv bedingten Beschaffenheit; darin verhalten wir uns vielmehr ganz naiv. Ebensowenig scheiden wir zwischen dem Ideal eines Objekts und seiner verwirklichten Gegebenheit. Nicht, wie es sein könnte oder sollte, sondern wie es uns wirklich erscheint, so wirkt es ästhetisch auf uns. Diese Wirkung besteht namentlich in Gemütsreaktionen des Gefallens und des Mißfallens. Immer kommt es dabei nur auf
die merkliche Beschaffenheit an. Eine Verzeichnung, die wir nicht merken, stört unsere Freude an einem Bilde keineswegs. Ein Maler, der mit peinlicher Sorgfalt genaue Maßverhältnisse einhält, erreicht eher weniger als ein anderer, der sich begnügt, mit seinem Augenmaß die wirksame Erscheinung zu formen. Keineswegs umfaßt das Merkliche nur das Wahrnehmbare. Man weiß, daß phantastische Vorstellung den Eindruck eines Gegenstandes verwandelt, wie uns denn ein Baumstumpf in der Dämmerung als Gespenst begegnen kann. Auf die merkliche Beschaffenheit des Gegenstandes in diesem weiten Sinne kommt es also für das ästhetische Verhalten an. Doch beschreibt die Ästhetik nicht etwa jedwedes empfängliche Verhalten, das sich beobachten läßt, sondern sie idealisiert. Sie abstrahiert, wie sich versteht, von allem, was nur zufällig mit dem ästhetischen Verhalten verknüpft ist. Wenn mich im Konzert das Husten meines Nachbars stört, so ist das für die Ästhetik gleichgültig. Vielmehr setzt sie ein konzentriertes Verhalten voraus, eine ernstliche Einstellung, eine hingebende Würdigung des Kunstwerkes. Sie schöpft ihre Einsichten nicht aus kümmerlicher und oberflächlicher Betrachtung und Beurteilung, sondern aus einem vollausgebildeten empfänglichen Verhalten.
In seiner Reinheit ist ein solches Verhalten nur selten verwirklicht. Die Umstände erlauben vielfach keine ungestörte völlige Hingabe an einen seiner bloßen Beschaffenheit nach fesselnden Gegenstand. Bei der Wanderung durch eine fremde Stadt, deren architektonische Werke uns wert sind, werden wir durch mancherlei Ablenkung daran gehindert. Noch mehr unterliegen wir den Zufälligkeiten unseres eigenen Seelenlebens. Da ziehen uns während des Lesens einer Dichtung unsere Erinnerungen in ihren eigenen Bannkreis und verscheuchen mit einem Schlage den poetischen Zauber, in dem wir befangen waren. Es wird uns nicht immer leicht, in die ästhetische Stimmung zu geraten, wir bleiben zuweilen ungerührt selbst bei mächtigen Eindrücken. In allen solchen Fällen zeigt sich die ästhetische Hingabe als
ein Ausschnitt aus dem wirklichen Seelenleben, den man nur künstlich isolieren kann. Besondere Bedingungen hat dies Verhalten und seinen eigentümlichen Verlauf; es bedarf der Pflege und des Schutzes, des guten Willens und der günstigen Disposition, um sich entfalten und von uns Besitz nehmen zu können. Es gibt stärkere Interessen, robustere Bedürfnisse, dringendere Aufgaben. So ist der empfängliche Zustand jederzeit bedroht, einem Pflänzchen vergleichbar, das nur dann zur Blüte gelangen kann, wenn man ihm sorgsam alle äußeren und inneren Entwicklungshemmungen fernhält und die rechte Nahrung gewährt. So erwächst die theoretische Ästhetik als Wissenschaft von einem Ideal, so entsteht das praktische Problem einer ästhetischen Erziehung. Daneben kann man von einer psychologischen Ästhetik reden, die allen Spuren ästhetischer Erlebnisse und ihrem Zusammenhange mit anderen Akten oder Inhalten nachforscht, sofern dafür psychologische oder psychophysische Tatsachen in Frage kommen. Grundsätzlich jedenfalls zählt die Ästhetik zu den Idealwissenschaften.
Darin liegt auch ihre normative Bedeutung begründet. Ist das ästhetische Verhalten ein eigentümliches, das in seiner Reinheit nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit darstellt, so müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, ohne die man sich nicht in ästhetische Betrachtung versenken kann. Werden diese Bedingungen als Vorschriften ausgesprochen, denen sich fügt, wer ästhetisch schaffen oder genießen will, so erhalten sie den Charakter von Normen. Solche Normen können nicht a priori aufgestellt und abgeleitet werden, sondern sie beruhen auf der Beobachtung von Tatsachen des ästhetischen Verhaltens. Wenn irgendwo, so hat im Sinne der Ästhetik Geltung der Satz: Erlaubt ist, was gefällt. Eine absolute Zumutung: Dies sollst du schön finden, oder: so hast du zu schaffen, wäre einfach lächerlich. Ästhetische Normen haben daher nur hypothetische Bedeutung. Sie setzen den Willen zu einem bestimmten Ziel der ästhetischen Befriedigung voraus. Das Schreckgespenst von normativer Ästhetik,
daß den Künstlern die Freiheit des Schaffens, den Schauenden die Unbefangenheit des Genusses verkümmerte, existiert nur in der Phantasie von Leuten, die nicht mit der Ästhetik vertraut sind. Bei der eben angegebenen Auffassung der Normen aber versteht es sich von selbst, daß sie entwicklungsfähig sind, weil neue Tatsachen neue Bedingungen ästhetischer Wirkung kennen lehren können. Solche Normen gelten zunächst nur für das Subjekt. Aber es ist leicht einzusehen, daß sie auch für das Objekt als Maßstäbe der Beurteilung in Betrach kommen. Ist ein vollständiges, reines und intensives ästhetisches Verhalten vorhanden, so muß sein Objekt positiv oder negativ gewertet werden können. Je mehr es dann den subjektiven Bedingungen entspricht, um so höher wird es gewertet. Dabei spielen noch individuelle Unterschiede mit. Jedes Ideal drängt zu Beurteilung und Verwirklichung. So führt uns eine vom ästhetischen Verhalten ausgehende Untersuchung zur Unterscheidung seines idealen Objektes und des idealen Zustandes der Empfänglichkeit. Die Prädikate der ästhetischen Urteile betonen bald mehr die gegenständliche, bald mehr die zuständliche Seite, bald urteilt man: dies Bild ist schön, dagegen ein andermal: es gefällt mir. Immer wirken aber zu solchem Urteil Gegenstand und Verhalten zusammen. Die genauere Untersuchung des ästhetischen Verhaltens wird Gegenstand und Zustand gleich eingehend erforschen. Auf der Zustandsseite wird sie hauptsächlich produktive und reproduktive Prozesse unterscheiden, je nachdem, ob dem schaffenden Künstler, ob dem genießenden Kunstfreund nachgefragt wird. Dabei ist Rezeptivität nicht als stumpf passive Hinnahme zu deuten. Erst durch ein regsames ästhetisches Verhalten, durch Beteiligung eigener Erfahrung, eigenen Geistes und Gemütes wird das tote Buch lebendig, spricht uns der kalte Marmor an. Aber dem schöpferischen Künstler wächst der ästhetische Gegenstand erst unter den Händen in die Welt der Objekte hinein. Die Technik, deren er sich dabei bedient, fällt nicht mehr in das Gebiet der allgemeinen Ästhetik. Sie lehren besondere
Kunsttheorien, technische Disziplinen, wie Poetik, Metrik, Tektonik, Perspektivenanalyse, Kontrapunktik.
So kommen wir denn zu dem Ergebnis, daß die Ästhetik nicht einfach ein Teil der Psychologie ist oder eine ihrer Anwendungen. Sie geht vielmehr in doppelter Richtung über sie hinaus. Einmal tut sie das im Sinne einer Idealwissenschaft, insofern sie das ästhetische Verhalten in seiner Reinheit, Vollständigkeit und Intensität behandelt; dann aber auch als Wertwissenschaft, die nicht jedes ästhetische Urteil, nicht jedes Kunstwerk hinnimmt. Die Wertästhetik billigt nur Schöpfungen und Urteile, die dem reinen, vollständigen und intensiven ästhetischen Verhalten entspringen. Aus dem idealen empfänglichen Verhalten erwachsen Prinzipien, Werte und Normen. Dieses ästhetische Verhalten ist so umfassend wie möglich; nichts in der Welt ist ungeeignet, es zu fesseln. Darum ist ästhetische Bildung wahrhaft allgemeine Bildung. Wenn die Gegenwart so sehr auf Veredlung des Geschmackes hinwirken will, so ist das ein natürlicher Rückschlag gegen die einseitige Bindung des Berufslebens. So brauchen unsere Gaben nicht zu verkümmern, so bildet ästhetische Kultur vielleicht einmal mit an neuer Gemeinsamkeit des Fühlens und Urteilens. Dennoch werden wir das umfassende ästhetische Verhalten, das sich der bunten Erscheinung freut, nicht für das wertvollste Menschentum erklären; denn Ästheten wollen wir nicht werden aus lauter Liebe zu schönen Dingen.
Im Anfange der antiken Ästhetik bildeten die Pythagoräer den metaphysischen Begriff der Harmonie aus. Harmonie ist ihnen Einung des Mannigfaltigen und Zusammenstimmung des Zwiespältigen. Dieser metaphysische Harmoniebegriff diente hauptsächlich der Erforschung des ästhetischen Gegenstandes. Die Pythagoräer beginnen auch mit musiktheoretischer Einzelforschung. Pythagoras entdeckte die Abhängigkeit der Tonhöhe von der Länge der schwingenden Saite. Die Harmonie gilt seiner Schule als Vollkommenheit. Von den ästhetischen Abhandlungen des Demokritos sind uns leider nur spärliche Bruchstücke erhalten. Ihn scheint die Technik der Künste vor allem gefesselt zu haben; auf deren empirische Erforschung deuten Titel wie „über Rhythmen und Harmonie“, „über den Wohllaut und Mißklang von Buchstaben“. Zur Schönheit bedarf es auch für diesen Griechen des gleichgewichtigen Ebenmaßes. Dyroff in seinen Demokritstudien denkt an einen Einfluß des polykletischen Kanons. Überschwang und Mangel mißfallen dem Denker von Abdera. Darüber hinaus kennt er den Ausdruck durchseelten Lebens. Leibesschönheit ist nur lebenhaltig und weiter nichts, wenn sie nicht von Geist getragen wird. Demokrit weiß von Bildwerken, die schönformig und vollendet zur anschauenden Betrachtung bereitet, dennoch aber herzensleer sind; er zeugt von den hohen Freuden, die aus der Betrachtung der schönen Werke entspringen. Auch über die geschichtliche Entfaltung der Kunstarten muß er sich seine Gedanken gemacht haben; er hält die Musik für eine späte Kulturblüte, für jünger als die Baukunst, weil sie kein dringen-
des Bedürfnis der Not befriedigen hilft, sondern nur im Überfluß gedeiht. In der Psychologie des schaffenden Künstlers braucht er den Begriff der Inspiration, des Enthusiasmus, eines heiligen Feuers der Begeisterung. Sokrates nennt einen goldenen Schild häßlich, weil er zum Schilde nicht taugt und prägt so den Begriff der Materialechtheit. Die Ansicht, die Schönheit einfach mit Brauchbarkeit zusammenwirft, wird von ihm in Xenophons Gastmahl persifliert: der große Mund sei am schönsten, weil er ein größeres Stück abbeißen könne. Von der bildenden Kunst verlangtSokrates, daß sie die Eigenart der Seele durch die sichtbare Gestalt durchschimmern lasse. Die höheren Sinne, Auge und Ohr sind es, die schöne Eindrücke vermitteln.
Die Wissenschaft der allgemeinen Ästhetik begründet Platon. Die Schönheit scheidet er scharf von bloßer Zweckmäßigkeit; Schönheit ist nicht zu etwas schön. Dieses Schöne weckt eine ihm eigentümliche trauliche Lust, die nichts mit sinnenreizender Annehmlichkeit gemein hat, sondern frei ist von der unauslöschlichen Unbefriedigtheit, die aller Sinnenlust zugemischt ist. Maßvoll ist die Freude an der Schönheit im Gegensatz zu der ungemessenen Heftigkeit sinnlicher Gefühle; sie dient nicht der leidenschaftlichen Begierde zur Befriedigung. Sie ist die Freude, welche dem Schauenden über der Betrachtung entsteht. Ebenmaß, Symmetrie und Proportion sind die wesentlichen Eigenschaften schöner Werke. Die schlichtesten der schönen Dinge sind Farben, Töne und Gestalten; minder edel ist die Lust an Düften. Farben sind schön durch Reinheit und Glanz, unter den Tönen die hellen und sanften. Über der gestalteten Schönheit aber steht die geistige Schönheit einer weisen und gütigen Seele, die ihr inneres Ebenmaß gefunden hat. Auch die Gebilde der Wahrheit können der vertieften Betrachtung als geistig schön erscheinen. Für den Menschen verlangt Platon die Herrschaft der inneren Schönheit über die äußere Wohlgestalt. Von allen Ideen ist die Schönheit die einzige, die unmittelbar zu unseren höheren Sinnen spricht;
sie ist darum deren offenkundigste und liebenswerteste. Gott, die beste Ursache, hat aus Güte die Welt schön erschaffen. Doch ist die geistige Schöne in Natur und Kunst nicht adäquat verkörpert; alle schönen Dinge sind nur teilweise schön, teilweise aber unschön. Die Kunst müht sich zwar, durch Nachahmung schönheitsvolle Scheinbilder zu schaffen; es gelingt ihr aber nicht, die geistige Schönheit rein zu bilden; ja, sie verliert sich in den Schein einer Scheinwelt. Unter allen Spielen ist sie das sinnigste und anmutigste Spiel. Aber nur zu sehr sucht sie der Menge zu gefallen und schadet oft durch Verherrlichung des Verwerflichen. Werke und Künstler dieser Art sind aus dem Idealstaate zu verbannen. Selbst was der Dichter an edlen Werken schafft, erringt er nur im Rausche, in musischem Wahnsinn, in einem durch die Götter gewirkten außergewöhnlichen Bewußtseinszustand. Da jedoch der Dichter, von der Raserei ergriffen, selbst nicht weiß, warum er so und nicht anders dichtet, steht er tief unter dem Philosophen, der von der Einsicht in sein Tun getragen wird. Der Dichter trifft nur aus einem eingewurzelten Instinkt die Idee. Die Schönheit findet erst ihren echten Wert im Dienst des Guten. Trotz eigener dichterischer Hochbegabtheit, bei allem feinen Verständnis für das begeisterte Schaffen der Künstler urteilt Platon kühl mit herbem ethischea Rigorismus über das schönheittrunkene Athen des Perikles.
Der Ausbau der antiken Kunstästhetik ist ein Werk des Aristoteles. Schön ist nach seiner Rhetorik, was um seiner selbst willen gesucht wohlgefällt, oder was uns als wertvoll süß ist. In der Metaphysik sagt er, daß man nur Taten gut nennen kann, Schönheit aber auch am Unbewegten findet. Als Eigenschaften des Schönen hebt er hervor die Wohlgeordnetheit, die Symmetrie und (weise) Beschränkung. Ein winzig kleines Geschöpf kann nicht schön sein, weil sich die Anschauung ihm gegenüber verwirrt, ebensowenig ein ungeheuer großes, weil hier die Einheit und Ganzheit verloren gehe; in beiden Fällen fehlt die Übersichtlichkeit, die Zu-
sammenfaßbarkeit. Was solche übersichtliche Einheit hat, so heißt es anderswo, ist klarer, und das Klarere beachten wir mehr und nehmen es lieber wahr. Von den einzelnen Teilen des schönen Werkes wird gefordert, sie müßten derart zusammenhängen, daß man keinen Teil wegnehmen oder verrücken könne, ohne dadurch das Ganze aus den Fugen zu brechen. Aus dem Prozeß des künstlerischen Schaffens hebt Aristoteles die Nachahmung, die Nachbildung hervor, die in allen Künsten am Werk ist. Die Vorwürfe der Kunst werden durch Farben, Formen und durch Stimmen dargestellt, Stimmungen und Affekte durch Tanz und Melodie ausgedrückt. Nachahmer, Verähnlichen ist also hier in einem weiten Sinne gefaßt, der ausdrucksvolle Darstellung, Formung einschließt. Der Trieb zur Mimesis ist mit dem Menschen verwachsen; allgemein ist die menschliche Freude daran. Dinge, die uns in der natürlichen Wirklichkeit peinlich anmuten, erfreuen durch die Kunst der Nachbildung. In diesem Grundtriebe liegt der Ursprung der Kunst. Nach drei Einteilungsgründen scheidet Aristoteles die Kunstarten: nach Darstellungsgegenständen, Darstellungsmitteln und Darstellungsarten. Die Tragödie unterscheidet sich von der Komödie dem Darstellungsgegenstande nach so, daß sie edle Gestalten darstellt, deren Charakter das Durchschnittsmaß überragt, während das Lustspiel gemeinere Menschen handeln läßt. Nach Darstellungsmitteln trennt Aristoteles Künste der Form und der Farbe von Künsten der Stimme und des Rhythmus. So gilt der Tanz als rhythmische Kunst, Dichtung als Kunst rhythmischer Rede; die Kunst der rhythmischen Rede und des Tonsatzes ist das dithyrambische Chorlied mit Flötenbegleitung. Nach der Darstellungsart scheiden sich z.B. epische und dramatische Poesie. Wie sehr man sich hüten muß, Mimesis als sklavisches Abgießen von Naturformen zu deuten, zeigt die aristotelische Lehre von der Musik, deren Melodien ein unmittelbares Ethos in sich enthalten, wirkliche Gemütsstimmungen „nachahmen“. Die hörbaren Rhythmen und die melische Bewegung in der Folge verschieden tiefer und
hoher Töne haben die meiste „Ähnlichkeit“ mit den Gemütsbewegungen. Danach würde also gerade die Musik am vollendetsten nachahmen; Form und Farbe eines gemalten Antlitzes vermitteln damit verglichen nur flüchtige Andeutung des Gemütszustandes. In der Poetik stellt Aristoteles den hohen Stil, der bildet, was sein sollte, dem naturalistischen, der schildert, was wirklich ist, gegenüber und gibt der Dichtung hohen Stils den Vorzug, was einer platten Nachahmungstheorie nicht möglich wäre. Hier wird das Werk einem Ideal nachgeformt, das der Künstler sich kraft seines Temperamentes und seiner einfühlenden Einbildung so lebhaft wie möglich ausmalt. Aristoteles schätzt die Kunst wesentlich höher ein als Platon. Neben die theoretischen und praktischen Wissenschaften tritt gleichberechtigt die Kunstlehre. Freilich letzter oder höchster Zweck ist auch ihm die Kunst niemals. Ihr Wert ist dem der reinen Erkenntnis und der sittlichen Tat untergeordnet. Es ist aber ein erheblicher Unterschied, ob man das ästhetische Verhalten als Ganzes höheren Gesichtspunkten unterordnet, oder ob man einzelne ästhetische Objekte daraufhin prüft, ob sie sittlich oder unsittlich wirken. Aristoteles hütet sich vor einer Vermischung ethischer und ästhetischer Werturteile und spricht nur dem ästhetischen Verhalten den höchsten Wert ab. Die Dichtkunst, die von den wesentlichen Schicksalen und Leidenschaften des Menschen ein Bild entwirft, ist ein tieferes und edleres, ein ernsteres und philosophischeres Tun als die herodotische Geschichtsschreibung, die schildert, was sich zufällig begeben hat. Auf die vielen feinen Einzelheiten der aristotelischen Tragödienlehre sei hier nicht näher eingegangen. Von der oft berufenen Katharsis nur soviel, daß sie nicht die einzige und nicht die höchste Wirkung der Tragödie ist, daß aber diese Wirkung psychologisch richtig beobachtet ist. Von der kleinen und rührseligen Besorgtheit um unser Einzelschicksal werden wir durch den Anblick des wesentlichen Menschenleides geläutert. Aus der Entladung des bitteren und peinlichen Kummers entspringt eine edle
Heiterkeit. Die herbe platonische Geringschätzung einer Welt voll Schein des Scheins, seine Verachtung der erfinderischen Instinkte ist dem Aristoteles fremd. Aristoteles hat die spezielle Ästhetik wissenschaftlich begründet. Durch seine Poetik und Rhetorik ist er der mit beispielloser Autorität ausgerüstete Lehrer vieler späterer Geschlechter geworden. Das Mittelalter konnte seine Ästhetik nicht mehr bewundern, als es im achtzehnten Jahrhundert durch Lessing geschah.
Die poetische Philosophie des Aristoteles will alle kunsttechnischen Lehren umfassen; seine Poetik und Rhetorik sind spezielle Kunsttheorien. Das vorwiegend praktische Interesse der späteren, der hellenistischen Philosophie, gilt den technischen Anweisungen für die einzelnen Künste, die zum Teil in den allgemeinen Schulunterricht eingingen. Die allgemeineren ästhetischen Betrachtungen treten zurück. Mittel gegen die optischen Täuschungen zu ersinnen, ist damals wichtiger, als die Gründe der architektonischen Schönheit zu erforschen. Unter diesen Kunsttheorien seien folgende hervorgehoben. Von der vortrefflichen empirischen Musiktheorie des Aristoxenos von Tarent ist uns die Harmonielehre vollständig erhalten und ein Bruchstück ihrer Rhythmik. Aristides Quintilianus (l-2 Jahrh. n. Chr.) unterscheidet eine weiche (weibliche) Stilgebung in der Musik, die Lust erweckt und beruhigt, von einer herben (männlichen), die Denken und Tatkraft erregt. Ihm ist die Musik mit dem Tanze verbunden die ausdrucksfähigste und wirksamste Kunst, die alle Sinne gefangen nimmt. Cicero feiert in seiner Schrift de oratore die Verbindung von Schönheit und Zweckmäßigkeit in der Natur und in der Kunst, ohne darum die Schönheit aus der Zweckmäßigkeit zu erklären. Er scheidet zwei Modifikationen der Schönheit, Anmut (venustas) und Würde (dignitas), jene als weibliche, diese als männliche Schönheit benennend. Dionysios von Halikarnass (31 v. Chr. in Rom) stellt der Annehmlichkeit (dem ἦδύ) das Schöne (ϰαλόν) gegenüber. Besonderen Wert legt er auf das Verhältnis von Form und Gehalt der Rede. Kunst-
technisch untersucht er die einfachsten Elemente des Sprachausdrucks. A ist ihm der wohlklingendste, L der süßeste; R der edelste, S der häßlichste Laut. Überwiegen die Längen im Versmaß, so wird es würdiger, überwiegen die Kürzen, so mutet es weiblicher an. Quintilian (geb. 35 n. Chr.) hat in seiner institutio oratoria das einflußreichste rhetorische Werk des späteren Altertums geschaffen. Das wichtigste Hilfsmittel des Redners, die Fülle der Dinge und Worte, wird an guten Vorbildern geschult. Als Stilarten kennzeichnet er einen kraftvoll erhabenen, einen blühenden und einen schlichten Stil. Der erste reißt zur Leidenschaft hin, der zweite gewinnt, der letzte belehrt. Dem Horaz haben Jahrhunderte das Schlagwort ut pictura poesis nachgesprochen. In seiner ars poetica hebt er die bewußt kritische Arbeit der Feilung hervor, ohne die hohes Talent und glühende Inspiration kein vollendetes Dichtwerk schaffen würden. Da Dichtkunst das Leben harmonisch verschönen soll und kein dringendes Bedürfnis unter der Verurteilung von Stümperwerken leidet, so muß die gerechte Kritik streng geübt werden. Der römische Architekt Vitruv aus Verona schrieb 16-13 v. Chr. sein Werk de architectura. Mit der Baukunst müssen die übrigen bildenden Künste Hand in Hand gehen. Die Schönheit des Gebäudes beruht auf dem gefälligen Verhältnis der Formen, dem maßvollen Zusammenstimmen der einzelnen Glieder, der Anpassung an die äußeren Umstände. Die Zahlenwerte der schönen Proportionen werden genau bestimmt. Ein Bauwerk muß fest, nützlich, formschön ausfallen. Eurhythmisch sei der Innenausbau, eine Maßeinheit liege den Baugliedern zugrunde, symmetrisch sei die Flächengliederung, harmonisch das Verhältnis der Räume zueinander. Flavius Philostratus (Anf. d. dritten Jahrh. v. Chr.) gibt ästhetische Exkurse in seiner Vita des Apollonios von Tyana und in seinen Imagines aus einer vorgeblich neapolitanischen Sammlung. Philostratus preist die Phantasie als schöpferisches Vermögen, sie stelle dar, was sie nie zuvor gesehen. Der Geist des Künstlers muß sich der Idee des
darzustellenden Gegenstandes bemächtigen und ihn darstellen, wie sie es fordert. Um den Genuß des Zuschauers verständlich zu machen, arbeitet Philostratus mit dem Begriff einer inneren geistigen Nachahmung. An seltsam zerrissenen Wolkenfetzen, in die wir Kentauren, Wölfe oder Pferde hineindeuten, wird die Kraft der Phantasie erläutert. Ebenso gestaltet sich der Kunstfreund schattenhaft verschwommene Zeichnungen innerlich nachbildend, mit dem Verstande gleichsam schauend. So gehört es überhaupt zum wahren Genuß des Kunstwerks, ihm über der Betrachtung ein inneres Leben zu schenken. Die antike Ästhetik klingt aus in die allgemeine Theorie der Schönheit, die uns der Neoplatonismus geschenkt hat.
Plotinos (204-269 n. Chr.), der Meister des Neoplatonismus, weihte das 6. Buch seiner ersten Enneade der Betrachtung der Schönheit und das 8. Buch der fünften Enneade seinem Begiff der geistigen Schönheit. Zumeist spürt man Schönheit (so beginnt die erste Betrachtung) in den Wahrnehmungen des Auges und des Gehörs. Schön sind Gebilde aus Worten, musische Melodien und Rhythmen. Aber wer edleren Geistes ist, erschaut Schönheit auch in Taten, Charakterzügen, in Weisheit und Tugend. Wodurch wird all dies schön? Fast alle sagen, es sei schön wegen der Symmetrie der Teile und des Ebenmaßes im ganzen Werk, auch mache leuchtende Färbung schön, was sichtbar ist. Hiernach wäre nur ein Zusammengesetztes schön zu nennen, nicht aber Einfaches. Aber wenn doch das Ganze schön sein soll, so müssen auch seine Teile schön sein; ein schönes Werk kann nicht aus lauter Häßlichem bestehen. Auch müßten dann die schönen Farben, die lauter sind wie das Sonnenlicht, aus dem Reich der Schönheit verbannt sein; desgleichen die einzelnen Töne einer schönen Musik. Wie wäre dann möglich, was doch zweifellos wirklich ist, daß ein Menschenantlitz bei gleicher Symmetrie bald schön, bald häßlich anmutet? Wo ist gar die Symmetrie schöner Sitten, weiser Gesetze? Auch aus der Zusammenstimmung können
wir die Schönheit nicht erklären; denn sie besteht auch zwischen Häßlichem. Welche Zusammensetzung und Mischung würde wohl eine Seele schön machen, und worauf würde die reine Schönheit des Geistes beruhen?
Einen plotinischen Gedanken hat Goethe in seiner Sprache geformt.
Wär’ nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt’ es nie erblicken;
Läg’ nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt’ uns Göttliches
entzücken?
(Zahme Xenien, 111, 36.)
Nirgends würde die Seele Schönes schauen, wenn sie nicht selbst schön geworden wäre. Wenn wir Schönheit wahrnehmen, so begrüßen wir darin ein tief Verwandtes. Was häßlich ist, befremdet und stößt uns ab. Die Seele freut sich, wenn sie ein ihr Verwandtes auch nur in Spuren wahrnimmt; sie staunt, nimmt es in sich auf und erinnert sich ihrer selbst. Unablässig formt und gestaltet die Seele; in der gestalteten Wahrnehmung erkennt sie das ihre. Häßlich ist alles Gestaltlose, alles Amorphe. Die gestaltende Seele findet im schöngestalteten Werke dessen Idee wieder, an der sie innig Anteil nimmt. Die Idee macht das aus vielen Teilen Bestehende zu einem Ganzen, sei es in der Natur, sei es in der Kunst. Vom Materiellen hängt also die Schönheit nicht ab, auch nicht von dessen Größe; die Schönheit zeigt sich im Kleinen so gut wie im Großen, wenn nur die Idee daraus hervorleuchtet. Die Schönheit der Farben beruht auf der Gegenwart des unkörperlichen Lichts. Darum ist auch das Feuer vor Anderem in der Körperwelt schön, weil es dem Unkörperlichen, der Idee, am nächsten steht. In der Harmonie der Töne findet die Seele sich selbst wieder, entdeckt sie ihre eigene verborgene Harmonie. Die Sinnenschönheit der Körper haftet an der Gestalt, die sie durchformt. Die Lust an dieser Schönheit, in der die Seele das Abbild höherer Schönheit erkennt, ist vorbereitende Stufe
für die Betrachtung der übersinnlichen Schönheit und darum wertzuschätzen. Wer von Schönheit nie etwas wahrgenommen hat, der könnte auch nicht von ihr reden. Ebenso sollte über die geistige Schönheit der Seele nur urteilen, wer von ihrem milden Schauer einmal ergriffen worden ist. Die Schönheit von Tugend und Weisheit tut sich denen am meisten kund, die von herzlicher Liebe zur Schönheit erfüllt sind. Solche ergreift ehrfürchtiges Staunen, süße Verwirrung, liebevolle Sehnsucht und freudige Bestürzung. Warum nun erscheinen uns die fleckenlose Seele und ihre Tugenden auch schön? Weil sie so wahrhaft seiend sind und nicht an der Materie teilhaben. Alle Häßlichkeit der Seele stammt aus ihrer Mischung mit den Regungen des Leibes und aus ihrer Hinneigung zur Materie. Alle Tugend und lautere Erkenntnis reinigt und befreit von der materiellen Begier. Damit wendet die Seele ihr Schauen der geistigen Welt zu, dem Reiche der Gottheit; denn alles wahrhaftige Sein in seiner Schöne ist aus Gottes Güte überquillender Reichtum. Der Geist ist schön durch Gott, durch den Geist die Seele, und durch die Seele erst der Leib. Die Schönheit des Geistes kann nur von der geläuterten Seele innerlich und wesentlich erschaut werden. Die Seele kann die höchste Schönheit nur erkennen, wenn sie selbst wesentlich schön geworden ist. Im Geiste findet sie die eigentliche Schönheit der Ideen. Ursprung der geistigen Ideen ist der gute Urgrund, aller Schönheit Quelle, Gott. Nur auf dem beseelten Antlitz ruht der Schimmer der Schönheit, mit der Seele weicht er von den Zügen, auch wenn diese noch unverzerrt sind. Die Ideen im endlichen Geiste des schaffenden Künstlers sind schöner, als alles Gelingen im Werk, das nach ihnen gebildet wird. Wenn sich der Künstler zu den Urbildern der Natur erhebt, und diesen nachzuschaffen sucht, statt sein Vorbild in den Körpern zu suchen, dann kann er die Schönheit der gottentstammten Natur erreichen. Diese verfeinerte Auffassung von der Nachahmung hebt besonders deutlich der Systematisator des Neo-
platonismus,
Proklos (412-485 n. Chr.) hervor: Wer nur die äußere
Natur nachahmt, kann niemals das vollkommen Schöne erreichen;
denn sie ist voll von Ungestaltem und entfernt sich vom wahren Ideal
der Schönheit. Wie später bei Schelling und Hegel, so
fügt sich auch bei Plotinos die Ästhetik in ein
großes metaphysisches Weltbild. Der ästhetischen
Modifikation des Erhabenen widmet Longin (213 bis 273
n. Chr.) sein Werk 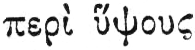 .
Sein eigentliches Thema ist der erhabene Vortragsstil des Redners; wer
ihn gewinnt, hat
den Gipfel
dieser Kunst erreicht. Es ist Bestimmung des Menschen, nach Erhabenheit
zu streben; mit solchem Drange streben wir nach Freude in der
Betrachtung des Grenzenlosen und des Allgewaltigen. Die
hinreißende erhabene Rede bezwingt und schließt
alle Meinung, die nicht des Redners ist, aus; sie wird glaubhaft
überzeugend. Tragweite der Gedanken und Leidenschaftlichkeit
des Vortrags dienen dieser Wirkung, die wie ein Natureindruck
überwältigt. Mangeln wirksame Gedanken, mangelt der
geistige Gehalt der Rede, so wird ihr Pathos zu frostigem Schwulst. Die
vollendete Rede überwältigt nicht nur bis zu
staunender Bewunderung, sie erhebt auch große Seelen, die
erhabener Gedanken fähig sind und beeinflußt so
nachhaltig. Die belebte Darstellung erfüllt die lauschende
Masse mit stolzer Weihe und freudiger Selbstachtung, als hätte
ihre Seele erzeugt, was sie vernahm. Sache der rednerischen Kunst ist
die Wahl des treffenden, anschaulichen und bedeutenden Inhalts; doch
muß sie sich hüten, daß die Kunst ja
unbemerkt bleibe. Spielarten des Erhabenen sind für den Rhetor
leidenschaftliche Erregung, ruhige Fülle und Würde,
lapidare Kraft, großartige Bilder, schwungvolle Breite, die
ins Prächtige geht. An unermeßlicher
Größe überbietet der Ozean den Nil, um
soviel erhabener ist seine ungegliederte, einfach
unübersehbare Flut. Als Beispiel der großartigen
Erhabenheit erinnert Longin an das Bibelwort: Und Gott sprach: Es werde
Licht; und es ward Licht.
.
Sein eigentliches Thema ist der erhabene Vortragsstil des Redners; wer
ihn gewinnt, hat
den Gipfel
dieser Kunst erreicht. Es ist Bestimmung des Menschen, nach Erhabenheit
zu streben; mit solchem Drange streben wir nach Freude in der
Betrachtung des Grenzenlosen und des Allgewaltigen. Die
hinreißende erhabene Rede bezwingt und schließt
alle Meinung, die nicht des Redners ist, aus; sie wird glaubhaft
überzeugend. Tragweite der Gedanken und Leidenschaftlichkeit
des Vortrags dienen dieser Wirkung, die wie ein Natureindruck
überwältigt. Mangeln wirksame Gedanken, mangelt der
geistige Gehalt der Rede, so wird ihr Pathos zu frostigem Schwulst. Die
vollendete Rede überwältigt nicht nur bis zu
staunender Bewunderung, sie erhebt auch große Seelen, die
erhabener Gedanken fähig sind und beeinflußt so
nachhaltig. Die belebte Darstellung erfüllt die lauschende
Masse mit stolzer Weihe und freudiger Selbstachtung, als hätte
ihre Seele erzeugt, was sie vernahm. Sache der rednerischen Kunst ist
die Wahl des treffenden, anschaulichen und bedeutenden Inhalts; doch
muß sie sich hüten, daß die Kunst ja
unbemerkt bleibe. Spielarten des Erhabenen sind für den Rhetor
leidenschaftliche Erregung, ruhige Fülle und Würde,
lapidare Kraft, großartige Bilder, schwungvolle Breite, die
ins Prächtige geht. An unermeßlicher
Größe überbietet der Ozean den Nil, um
soviel erhabener ist seine ungegliederte, einfach
unübersehbare Flut. Als Beispiel der großartigen
Erhabenheit erinnert Longin an das Bibelwort: Und Gott sprach: Es werde
Licht; und es ward Licht.
Literatur:
Ed. Müller, Geschichte der Theorie der Kunst bei
den Alten. 2 Bde.
Breslau 1834-37.
J. Walter, Die Geschichte der Ästhetik im Altertum.
Leipzig 1893
(Sehr platonisierend.)
Brunn,
Geschichte der griechischen Künstler. Braunschweig 1859.
Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden
Künste
bei den Griechen. Leipzig 1868.
A.Ruge, Die platonische Ästhetik. Halle 1832.
Döring,
Die Kunstlehre des Aristoteles. Jena 1876.
Teich
mü II er, Aristotelische Philosophie der Kunst. Halle 1869.
Reinkens, Aristoteles über Kunst. Wien 1870.
Brenning,
Die Lehre vom Schönen bei Plotin. Göttingen 1864.
Mit der großartigen Unbekümmertheit geistigen Reichtums berichtet Augustinus im vierten Buch seiner „Konfessionen“ von zwei oder drei verlorenen Büchern de apto et pulchro: „Ich besitze sie nicht mehr, sondern sie sind mir, ich weiß nicht wie, abhanden gekommen.“ Die allgemeine Ästhetik des Kirchenvaters ist uns also verloren. Mit Platon unterscheidet er freie Schönheit, die um ihrer selbst willen betrachtet und bewundert wird, von schmückender Schönheit, die sich äußerlich anheftet. Gottes Schönheit ist ihm größer, als die des Universums. Gott ist der Grund der sinnlichen Schönheit, die er aller Kreatur anerschaffen hat. Höher als die Leibesschönheit steht ihm die Schönheit der weisen und gerechten Seele. Der Leib ist schön durch den Einklang seiner Teile und die süße Milde seiner Farben. Ordnung, Ebenmaß und edle Verhältnisse sind sinnlich schön. Es gibt Anordnungen von Einzelteilen schöner Dinge, die den Gesamteindruck zu einem anschaulichen Ganzen zusammenschließen. Zwei Fenster von ungleicher Größe mißfallen leicht nebeneinander; übereinander aber gefallen sie, wenn das kleinere oben angebracht wird. Werden ihrer drei nebeneinandert angeordnet, so dürfen sie entweder gleich groß sein oder zwei kleinere müssen rechts und links ein mittleres großes Fenster umgeben. Schöner aber als alles Ebenmaß in den geschaffenen Dingen ist die übersinnliche
und unveränderliche Wahrheit. Aller Schönheit Form ist Einheit. Im Gegensatz zu Plotin, mit dessen Denkmitteln er sonst vielfach arbeitet, sieht Augustinus ein, daß Einzelteile, die für sich betrachtet häßlich wirken können, sich zur Gesamtschönheit verbinden können. Zur Schönheit der Welt gehören auch ihre Schatten, Häßliches und Böses. Was immer man häßlich findet, es erscheint nur so im Vergleich mit dem Vollkommenen. Jedes Wesen, auch das niedrigste, ist noch schön im Vergleich zu der Häßlichkeit des Nichts. Das gilt aber nur für die sinnliche Welt. In der Welt des Geistes ist jeder Teil wie auch das Ganze schön und vollkommen. Alle unsere Stimmungen und Affekte sind auf tiefverborgene Weise mit Stimme und Melodie verwandt und sie werden durch sie erregt. Diesen in seinen zahlreichen Schriften verstreuten Bruchstücken gegenüber können wir nur tief bedauern, daß uns die ästhetischen Hauptwerke des Augustinus verloren gegangen sind.
Thomas von Aquino hat sich auf Einzelbemerkungen zu ästhetischen Fragen beschränkt. Schönheit rührt nach ihm das Seelenvermögen der betrachtenden Erkenntnis, nicht das Vermögen der handelnden Begehrung. Schöne Dinge werden mit Auge und Ohr wahrgenommen; schön heißt, was angeschaut wohlgefällt. Der Schönheit eignet eine eigentümlich leuchtende Klarheit, die an Dingen mit schimmernden Farben am ehesten auffällt. Bei der Betrachtung schöner Werke leuchtet uns ihre wohlgebildete Gestalt ein, die getrübt wird, wenn die einst unverletzte Vollkommenheit Abbruch leidet. Die Eigenart der Schönheit ist ein Widerschein der gestaltenden Form, ergossen über die wohlgegliederten Teile der Materie, über verschiedene wirksame Kräfte. Die Schönheit der erschaffenen Dinge ist ein Abglanz der Schönheit Gottes, an der alle Geschöpfe teilhaben, aus der seine Güte unmittelbar hervorleuchtet.
Literatur:
M. de Wulf, Études historiques sur l’Esthetique de St. Thomas d’Aquin. Löwen 1896.
F. Vallet, L’idee du Beau dans la philosophie de
Saint Thomas. 2. Aufl. Paris 1887.
Taparelli,
Delle ragioni del bello secondo la dottrina di S. Tommaso
d’Aquino. 1859/60.
H. Janitschek, Die Kunstlehre Dantes. Leipzig 1892.
Schon dieser flüchtige Überblick über die Lösungsversuche der antiken und der mit ihren Denkmitteln aufbauenden mittelalterlichen Ästhetik muß den Eindruck erwecken, daß die Hauptprobleme der heutigen Ästhetik in diesen vergangenen Zeiten wissenschaftlich durchforscht worden sind; mehr, daß auch die Art, wie Erfahrungen verwertet, Beobachtungen aufgezeichnet, Erklärungen erprobt werden, überraschenden Scharfblick und sicheren Instinkt verrät. Ich brauche nur darauf hinzuweisen, wie absolut und relativ Schönes gesondert ward, wie die Begriffe naturgetreuer Nachbildung und freier Erfindung herausgearbeitet worden sind. Man denke daran, wie einfühlende Nachahmung den Kunstgenuß erklären half, wie Beseelung und ergänzende Auffassung entdeckt wurden. Man vergesse nicht die Forderung inneren Zusammenhangs für alle Teile eines schönen Werks. Immer wieder wird hier die Überzeugung festgehalten, daß im ästhetischen Eindruck objektive und subjektive Faktoren innig zusammenwirken. Man hat bald diese, bald jene eingehender gewürdigt, aber man ist niemals einem einseitigen Formalismus und auch niemals einer einseitigen Einfühlungstheorie verfallen. Wenn nicht nur das Mittelalter sondern auch die Neuzeit bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein in eine literarische Abhängigkeit von der antiken Ästhetik geraten sind, so haben sie wahrlich keine schlechte Autorität auf diesem Gebiet zur Führerin erkoren. Der beginnenden Neuzeit erwächst zunächst die Aufgabe, ästhetisches Wahrnehmen, Fühlen und Urteilen einer gründlichen psychologischen Analyse zu unterwerfen; daraus entspringt allmählich auch eine Lehre vom Genie. An Allgemeinbegriffen war auf lange hinaus genug vorhanden; erst die Leibnizische Philosophie gibt neue systematische Anregung.
Hatte die antike Ästhetik mit metaphysischen Betrachtungen und Allgemeinbegriffen begonnen, so bemüht sich die Renaissance um die Ausbildung von Kunsttheorien, die in lebendiger Wechselwirkung mit der Kunstübung stehen und teils deren Praxis darstellen, teils auf ihren Fortschritt bestimmenden Einfluß zu gewinnen suchen. Da sich der Humanismus als eine Wiederbelebung des Altertums fühlte, so knüpfte man an dessen Lehren an und dachte darauf, sie zu ergänzen. Das gründlichere philologische Studium unterbaute nur noch stärker die Herrschaft des Aristotelismus auf katholischen und protestantischen Universitäten. Während man in den Werken des Stagiriten die allgemeinen ästhetischen Ansichten und Grundbegriffe genügend entwickelt fand, richtete sich die Forscherarbeit vornehmlich auf Ergänzung. der kunsttheoretischen Schriften unter Berücksichtigung neuerer Kunstleistungen. Die Poetik des Aristoteles war nur als Fragment überkommen. In der Musik waren wesentliche Fortschritte gemacht worden; man denke nur an den mittelalterlichen Kirchengesang. Das drängte zur theoretischen Verarbeitung. Vollends die bildende Kunst bedurfte einer erweiterten Theorie. Verhältnismäßig am besten, gesorgt war für die Rhetorik, wo neben Aristoteles und Cicero Quintilian in kanonischer Geltung stand, und für die Baukunst, wo ein gleiches von Vitruv zu sagen ist. Neben der Poetik des Aristoteles erfreute sich die ars poetica des Horaz überragenden Ansehens. 1498 erscheint die erste lateinische Übersetzung der aristotelischen Poetik, 1503 wird der Text zum ersten Male herausgegeben. Rein technische Bedeutung hat der trattato della pictura des Cennino Cennini (geb. 1372). Leone Battista Alberti (1404-1472), ein Universalgenie von ästhetischem Feinsinn und scharfer Begriffsbildung schrieb 1435 seinen trattato della pittura, sein Buch de re aedificatoria 1452. Ihm ist die Schönheit kunstgerechte Fügung der gesamten Teile, der nichts hinzugesetzt werden kann, ohne dem Ganzen Abbruch zu tun, wo nichts vermindert, nichts verändert werden darf, ohne daß
alles vernichtet wäre. Diese Schönheit ist das höchste Gesetz des Kunstwerks, dessen Einheit gefordert wird. Naturwahrheit und Schönheit müssen in einer Harmonie zusammenklingen. Lionardo da Vinci hat sich eng an Alberti angeschlossen.
Lionardos trattato della pittura gibt eine ausführliche Darlegung der Perspektive und der Schattenkonstruktion, woran sich eine förmliche Theorie der Landschaftsmalerei anschließt. Es folgen Untersuchungen über das Auge als optisches Instrument. Er erkennt die Notwendigkeit anatomischer Untersuchungen und entwirft dazu eine große Anzahl von Zeichnungen. Mit allen Argumenten seiner Wissenschaft greift Lionardo in den Streit der Renaissance um die Rangordnung der Künste ein; dabei kann es nicht verwundern, daß er der Malerei den Vorzug gibt. Ist die Technik in der Kunst bis zu einem gewissen Grade lehrbar, so doch niemals die individuelle Werkbetätigung der Phantasie, die in Fülle das Neue schafft, die Aufmerksamkeit weckt und das Auge erfreut, der eine frischverputzte Mauer genügt, um darauf Landschaften, Schluchten, Akte in annäherndem Abbilde angelegt zu sehen. Aus dem Verworrenen gewinnt der erfinderische Geist den Einfall, der zur harmonisch aufbauenden Schönheit die ausdrucksvolle Anmut (bei Alberti gratia) hinzufügt, die erst den Reiz des Gebildes vollendet.
Aus Lodovico Dolces dialogo della pittura, der gleichfalls über die Vorzüge der Malerei und der Dichtung disputiert, hat Lessing Anregung geschöpft. Vasari gibt in seinen Lebensbeschreibungen der ausgezeichneten Künstler die landläufigen Wendungen über Naturnachahmung und Erfindung wieder.
Dürer hat in vier Büchern von menschlicher Proportion mit dem Problem des Kanon gerungen. Wie alle Renaissancetheoretiker sucht er in unermüdlicher Tätigkeit den Schlüssel für das Rätsel der Schönheit in den unabänderlichen Gesetzen der Raumgestaltung.
In diese Zeit fallen zwei berühmte Darstellungen der
Poetik. Der Bischof Marcus Hieronymus Vida (1480-1566) veröffentlichte Poeticorum libri III zuerst 1520. Der Philologe und Kritiker Julius Cäsar Scaliger (1484-1558) schrieb Poetices Iibri VII, die erst nach seinem Tode herausgegeben wurden. Vida hatte nach allgemeiner Ansicht das geleistet, was Horaz nur angedeutet hatte; seine Poetik war ein elegantes Büchlein in Versen, die denen Vergils an die Seite gestellt wurden. Scaliger rechtfertigt mit Klagen über den fragmentarischen und ungeordneten Zustand der aristotelischen Poetik sein eigenes Unternehmen. Trotzdem kam er in der Systematik nur wenig, in der Ergänzung nur äußerlich über sie hinaus. Vida und Scaliger rühmen das Epos des Vergil als Gipfel der Dichtkunst und beschränken sich im übrigen auf detaillierte Anweisungen. Die Betrachtung neigt zum Moralisieren, die Dichtung wird nach didaktischen Gesichtspunkten gewertet. Die aristotelische Mimesis und das Horazische Wort ut pictura poesis werden unermüdlich zitiert. Diese Art von Poetik war für neulateinische Dichter gedacht. Den Deutschen erwuchs eine analoge Schrift in dem „Büchlein von der deutschen Poeterey“, das Martin Opitz unter ausgiebiger Benutzung Scaligers verfaßte.
Literatur zur Kunsttheorie der Renaissance:
Borinski, Die Poetik der Renaissance und die Anfänge
der literarischen Kritik in Deutschland. Berlin 1886.
J. Wolff, Lionardo da Vinci als Ästhetiker. Jena.
Diss. 1901.
J. Krause, Leone Battista Alberti als Kunstphilosoph.
Heidelberg. Diss. Straßburg 1911.
Prantl, Lionardo da Vinci in philosophischer Beziehung.
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu
München. 1885.
v. Zahn, Dürers Kunstlehre und sein
Verhältnis zur Renaissance. 1866.
v. Obernitz, Vasaris allgemeine Kunstanschauungen auf dem
Gebiet der Malerei. Straßburg 1897.
Vossler, Poetische Theorien der Frührenaissance.
Berlin 1900.
Lintilhac, Jules César Scaliger. Nouvelle Revue. Bd. 64.
1890.
Auch die klassische französische Ästhetik baut nur einzelne Thesen der antiken Schönheitslehren aus. So lehnt sich Boileau besonders an Longin an und lehrt neben Wahr-
heit und Klarheit die Einfachheit des Erhabenen. Dagegen stützen sich Dubos und Batteux auf Platon und Aristoteles und führen die Theorie über die Freude am Schönen und über sein Wesen aus. Boileau wollte seine art poetique (1674) am liebsten mit einigen Werken antiker Autoren zusammengestellt wissen. Die ars poetica des Horaz war sein Vorbild. Unter dem Einfluß des Decartes tadelt er Dunkelheit und Schwulst. Wer das klar Gedachte wahr darzustellen vermag, ist ein Dichter; nur im Feuer der Begeisterung wird sein Werk gelingen. Rien est beau, que le vrai. Wahrheit ist damals soviel wie Vernunft und soviel wie Natur. Die Darstellungsmittel seien einfach, weil das Einfache erhaben wirkt und natürlich zugleich. Organ der weisen Beschränkung ist die Vernunft. Anschaulicher Reichtum an sinnlichen Einzelzügen ist nach Descartes verworren und wird so vom Klassizismus verworfen. Malherbe reinigt die Sprache, 1629 wird die académie française gegründet. Charakteristisch ist der Titel des ästhetischen Werkes von Bouhours: la maniere de bien penser dans les ouvrages de l’esprit (1687). Die künstlerische Darstellung muß nicht nur wahr, sondern auch ungewöhnlich sein; dann erst reden wir von Delikatesse. Auch was nur undeutlich angedeutet ist, kann nach ihm ästhetisch wirken. Damit wird bereits dem jugement confus, nämlich dem Gefühl, Einlaß gewährt. 1719 erscheinen die reflexions critiques sur la poésie et la peinture von Dubos. Natürliches Vergnügen entsteht aus der Befriedigung realer Bedürfnisse. Am stärksten befriedigt uns, was unsere Leidenschaft erregt. Wir leiden mehr, wenn wir ohne Leidenschaften leben, als wir durch sie leiden. Die Kunst stellt dar, was wirkliche Leidenschaften erregt hätte. Ihren Nachahmungen gegenüber erleben wir Phantome dieser Affekte. Da solche Nachklänge der Leidenschaft schwächer sind, als die wirklichen Affekte, so bleiben sie ohne deren üble Folgen und erwecken nur das Vergnügen an geistiger Tätigkeit. Je bewegter der Gegenstand der künstlerischen Darstellung, um so größer ist sein ästhetischer Reiz. Da die Gemüts-
regungen in der Musik unmittelbar Laut werden, so ist sie die natürlichste Kunst. Demnach zeichnet sich das Genie durch klares Urteil und geweckte Einbildungskraft aus; es vermag in der Erregung des Gemüts frei über diese Geistesgaben zu verfügen. Künstlerische Begabungen erscheinen abhängig von der Gunst der Zeiten, der politischen Lage, dem Klima. Hier antizipiert Dubos Gedanken von Taine. Während die Nachahmungstheorie von Batteux ziemlich verflacht wird, ordnet Dubos die aristotelische Lehre von der Freude an der Kunst allgemeineren psychologischen Zusammenhängen in feiner und geistreicher Form ein. Sehr groß war der Einfluß jenes Cours de helles lettres, den der Abbé Batteux 1747-1750 in fünf Bänden veröffentlichte. Flüssig geschrieben, macht das Buch auf Oberflächliche den Eindruck voller Sachbeherrschung; doch werden die Begriffe der Nachahmung und der Natur so weit gefaßt, daß sie alle Prägnanz einbüßen. Unter Natur wird alles verstanden, was man sich leicht vorstellen kann. Die Nachahmung soll wählerisch sein; sie muß also schon voraussetzen, was eigentlich schön ist in der Natur. Von Batteux, aber auch schon von der englischen Ästhetik beeinflußt und darum nicht mehr ohne weiteres dem reinen französischen Klassizismus zuzurechnen sind die ästhetischen Meinungen Diderots, deren Quelle sein Artikel Beau im Dictionnaire encyclopédique ist. Diderot weist darauf hin, daß man zwischen den formen in den Dingen und den Gestalten unserer Vorstellung unterscheiden müsse. Nicht unser Verstand legt die Formbeziehungen in die Dinge, sondern er bemerkt nur die Rapports zwischen beiderlei Gestalten. Die Formen in der Architektur werden nicht von unserer Betrachtung gestaltet, sondern nur am Bauwerk wahrgenommen und bemerkt. Freilich schaffen auch Denken und Einbildung Gestalten und der Künstler kann die selbsterschaffene dem rohen Steinblock aufzwingen. Der äußere Körper ist nicht schön ohne die ihm aufgeprägte Gestalt. Niemals aber ist ein Ding schön vermöge unverwirklichter Gestalten der Einbildung. Erst wenn sie im Werke
von den Sinnen und dem Verstande des Betrachtenden bemerkt werden, entsteht der ästhetische Eindruck.
Im Gegensatz zum französischen Klassizismus geht die englische Ästhetik des achtzehnten Jahrhunderts nicht von den antiken Lehren, sondern von den Tatsachen selbst aus. Sie ist originell und wird darum auch führend. Die psychologische Analyse, die Locke in die Betrachtung des Wissens und der Erkenntnis eingeführt hatte, wird auch auf ästhetischem Gebiet erfolgreich angewandt. Lockes und Humes allgemeinere Untersuchungen werden dabei oft verwertet.
Schon Addison (1672-1719) hegt eine deutliche Einsicht in die ergänzende, umwandelnde Tätigkeit der Einbildungskraft angesichts von Naturdingen oder Kunstwerken. Ein Mann von angeregter Phantasie kann sich mit einem Gemälde oder mit einer Statue unterhalten und empfindet oft eine größere Freude bei der Anschauung von Feldern und Wiesen als ein anderer ihrem Besitz verdankt. Er sieht die Welt gleichsam in einem anderen lichte und entdeckt in ihr Reize, die anderen Menschen entgehen. Die Schönheit ist ihm keine objektive Eigenschaft der Dinge selbst. An den Farben, an den Abschattungen der Helligkeit hängt die größte Schönheit; aber der von Locke Belehrte weiß, daß diese nur sekundäre Qualitäten sind. So entdecken wir eingebildete Pracht am Himmel und auf Erden und sehen vermeintlich(: Schönheiten über die ganze Welt ausgebreitet. Wie verzauberte Romanhelden gehen wir umher und verarmen, sobald die Quelle der inneren Phantasie versiegt. Zu den Sinneseindrücken aber gesellen sich weiterhin die Bilder, die wir reproduzieren, indessen wir etwas wahrnehmen. Zudem hat die Einbildungskraft die Fähigkeit, die von Erfahrungen herrührenden Ideen zu erweitern, zu verbinden und zu verändern.
Shaftesbury (1670-1713), der mit der Antike tiefvertraute, in ihrem Geiste erzogene englische Staatsmann, der Verherrlicher des enthusiastischen Temperaments, verzichtet auf Lockes Begriffssystem und sucht in weltmänni-
scher Menschenbeobachtung Erkenntnis der menschlichen Natur, eine Selbsterkenntnis schließlich, die als Selbstgestaltung der Persönlichkeit und ihres reizvollen wohlgeratenen Eigenlebens Frucht bringt. Die harmonisch gebildete Persönlichkeit faßt den Reichtum der äußeren Mannigfaltigkeit kräftig zur Einheit zusammen, getrieben von einem ursprünglichen, in einem edlen Leben vollentfalteten Instinkt, geleitet von dem vornehmen Geschmack ihres inneren Sinnes, der geistreich und natürlich urteilt. Unser eigenes Wesen wird sich der äußeren Ordnung und Zweckmäßigkeit, dem wohlproportionierten und regelmäßigen Zustand, dem wahrhaft glücklichen und natürlichen eines jeden Geschöpfes, nur erschließen, wenn es innerlich harmonisch geworden ist und den Wechsel flüchtiger Zustände beherrscht. Es gibt drei Stufen der Schönheit. Auf der untersten stehen die toten Formen, die ihre Bildung dem Menschen oder der Natur verdanken, wie Paläste, wilde Gärten. Höher schon stehen bildende Formen, die selbst andere bilden: Geist und Erfindungskraft. Was schön macht und nicht was schön gemacht ist, dem eignet die Fülle der Schönheit. Über dem edlen formwirkenden Menschengeist, auf der höchsten Stufe steht die Urschönheit, die bildende Formen erschafft, Gott. Häßlich an sich ist die träge, ordnungs- und gestaltungslose Materie. Der edelste Gegenstand der irdischen Kunst ist der Mensch in seinem Kampf und Sieg, die lebendige Darstellung seines vollkommenen Charakters. So preist Shaftesbury mit den Denkmitteln Plotins eine shakespearische Schönheit. Sein Einfluß auch auf die Heroen der deutschen Dichtung ist groß; seit seinen Schriften verbreitet sich die Formel von der harmonischen Einheit des Mannigfaltigen mehr und mehr.
Die psychologisch-analytische Betrachtungsweise beherrscht den 1725 veröffentlichten inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue des Glasgower Professors Francis Hutcheson. Seine Vorrede erklärt, daß er die erste Anleitung den großen Schriftstellern des Altertums verdanke
und meint, es sei fast überflüssig, die Schriften des Lord Shaftesbury ausdrücklich zu empfehlen. Seine Einleitung beginnt mit psychologischen Bestimmungen, die offenkundig von Locke stammen. Viele von den „einfachen Ideen“ sind unmittelbar angenehm, viele unmittelbar unangenehm. Wenn hier individuell verschieden geurteilt wird, so liegt das an zufälligen Assoziationen, die sich mit ihnen verknüpfen. Manchen Personen erscheinen z. B. helle und glänzende Farben in der Kleidung unangenehm, weil sie die Neigung dazu für den Beweis einer leichtfertigen Gesinnung halten. Außerdem ist die Empfänglichkeit der Sinne verschieden. Größeres Vergnügen als die einfachen Ideen gewähren die zusammengesetzten Ideen schöner Gegenstände. Ein schönes Gemälde ergötzt mehr als eine einzige Farbe. Das Vermögen, Schönheit und Übereinstimmung wahrzunehmen, wird in Anlehnung an Shaftesbury inneres Gefühl genannt. Feine Sinne genügen dazu nicht; es bedarf des edlen Geschmacks, des schönen Geistes. Gleichheit, Ebenmaß, Proportion zu entdecken ist Einsicht des Verstandes, nicht der Augen. Nicht notwendig ist das Vergnügen mit der Vorstellung des Ebenmaßes verbunden; es kann auch empfunden werden, wo wir kein Ebenmaß erkennen. Darum spricht man von innerem Gefühl, weil Erkenntnis von Verhältnissen nicht Ursprung des ästhetischen Genusses ist. Mit der Voraussicht von Nutzen oder Nachteil hat die Freude an der Schönheit nichts gemein; schöne Ideen sind notwendig und unmittelbar angenehm. Das Verlangen danach ist nicht Begierde nach dem Besitz des schönen Gegenstandes. Solche Begierde könnte durch Lohn oder Drohung unterdrückt werden, niemals aber das innere Gefühl. Hätten wir nichts von diesem Gefühl, so würden uns Häuser, Gärten, Kleidung zwar schicklich, nützlich, bequem erscheinen, nie aber schön. Die Schönheit ist entweder absolut oder relativ. Der Ausdruck absolute Schönheit will nicht besagen, daß sie unabhängig vom empfindenden Geiste weiterbestünde. Absolute Schönheit wird an Gegenständen wahrgenommen, die ohne Vergleich mit
anderen Dingen durch sich selbst wirken; relative Schönheit ist der Schönheit anderer Gegenstände ähnlich oder nachgebildet. Bei einfachen Figuren beruht die absolute Schönheit auf der Verbindung von Einförmigkeit und Mannigfaltigkeit. Bei gleicher Einförmigkeit wächst die Schönheit mit der Mannigfaltigkeit; bei gleicher Mannigfaltigkeit aber entsprechend der Einförmigkeit. So .übertrifft die Schönheit des regulären Fünfecks die des Quadrates. Doch geht das nicht ins Unübersichtliche fort. Umgekehrt übertrifft das Quadrat das Rechteck. Die Kinder wählen gern reguläre Figuren in ihren Spielen. Ebenso verhält es sich mit der Schönheit in der Natur. Die Gestalten der Weltkörper sind meist sphärisch und ihre Bahnen elliptisch. Der regelmäßige Wechsel von Tag und Nacht und Jahreszeiten, sowie die Raumverhältnisse der Himmelskörper zueinander rühren die Sternkundigen und erleichtern ihnen ihre verdrießlichen Rechnungen. Lehrsätze, die in ihrer einfachen Formel unendlich viele besondere Wahrheiten enthalten, sind nach diesen Prinzipien schön. Das gilt besonders von Newtons Gravitationslehre. In der Wissenschaft kann die Liebe zur Einheit großen Schaden stiften, besonders in der Philosophie. Die relative Schönheit blüht vor allem in der Dichtung; sie schafft die im Regen niedergebeugte Pflanze zu einem Abbild der Trauer um, die verzehrende Flamme zum Sinnbild des Krieges. Verschiedene Spielarten der Schönheit können entstehen, je nachdem der ursprüngliche oder der relative Faktor überwiegt. Häßlichkeit ist nach Hutcheson nur ein Mangel an Schönheit, die wir an einem Gegenstande erwartet haben. Aber uns erscheint etwas auch auf Grund von Assoziationen unschön, wenn wir z. B. in einem wohlgeformten Gesicht schlechte Eigenschaften zu erkennen glauben. Das Gefühl der Schönheit ist bei allen Menschen gleich. Die Geschmacksurteile weichen voneinander ab, soweit individuelle Assoziationen den ästhetischen Eindruck verwirren. Hier sind die englischen Methoden der Beobachtung und Vergleichung zur Herrschaft gelangt. Ein glücklicher Anfang mit der empi-
rischen Untersuchung ästhetischer Tatbestände ist gemacht. Eine Begründung der Formen und Gesetze der Schönheit wird noch nicht versucht; die Methode ist deskriptiv.
Eine objektiv nachweisbare Form als schöne Gestalt schlechthin anzugeben, unternimmt der berühmte Maler und Kupferstecher William Hogarth in seiner Analysis of Beauty (1753), der er Illustrationen zum Belege seiner Theorie beifügt. Als Bedingungen der sichtbaren Schönheit gibt Hogarth an: 1. Zweckmäßigkeit der Teile, die geeignet sein müssen, die Absicht des Ganzen mitzuerfüllen. Geschlängelte Säulen mißfallen, weil sie zu wenig tragsam erscheinen.
2. Mannigfaltigkeit, die als geordnet zu denken ist. Sie ist nach Hogarth die wichtigste Bedingung. 3. Äußere Gleichförmigkeit – gefällt als solche nur, wenn sie der Zweckmäßigkeit dient. 4. Einfachheit – gefällt nur in Verbindung mit der Mannigfaltigkeit. Darum haben ungerade Zahlen einen Vorzug vor den geraden, das Dreieck vor dem Viereck. (Hier widerspricht er Hutcheson.) 5. Größe – macht das Reizende prächtig. Sie muß Übertreibung meiden; sonst wirkt sie plump, schwerfällig, lächerlich. Schon fast experimentell stellt Hogarth Figuren zur Wahl, die er methodisch aus den einfachsten Geraden, Kreisen und Wellenlinien aufbaut. In seinem Geschmack ist Hogarth, in der Wahl seiner Formen von Michelangelo beeinflußt.
Die psychologische Lehre der englischen Philosophen, namentlich Humes, beginnt ihre Früchte zu tragen in des aufrechten Staatsmannes Edmund Burke philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (1757). In der Einleitung, dem Versuch über den Geschmack, sucht Burke zu zeigen, daß es allgemeine, für jedermann geltende Grundsätze dafür geben müsse, da die natürlichen Fähigkeiten des Menschen, Sinne, Phantasie und Urteilskraft große Übereinstimmung aufweisen. Scheinbare Abweichungen lassen sich oft leicht erklären. Wenn die Türken Opium lieben, während wir es verabscheuen, so geschieht jenes dort wegen der angenehmen Rauschwirkung, hier dieses wegen des
bitteren Geschmacks. Die Begabung mit Phantasie ist graduell verschieden stark, Sensibilität und Aufmerksamkeit sind ungleich erregbar. Übung und Verstand sind sehr verschieden stark entwickelt. Um die Bedingungen unserer ästhetischen Erlebnisse auszumachen, entwickelt Burke eine physiologisch unterbaute psychologische Theorie. Die von der Wirklichkeit erregten Gemütsbewegungen sind den künstlerisch angeregten weit überlegen. Aber das Kunstwerk kann diese Eindrücke durch Wiederholung steigern. Lust und Schmerz sind beide positive Empfindungen, die aus Befriedigung oder Nichtbefriedigung von Trieben hervorgehen. Zwei Grundtriebe sind der Selbsterhaltungstrieb und der Geselligkeitstrieb. Was dem ersten widerstrebt, erregt vornehmlich Schmerz. Trotzdem können Schrecken und Tod uns in gewissen Entfernungen und mit gewissen Einschränkungen entzücken. Aufhebung von Schmerz und Gefahr bewirkt ein anderes Gefühl als positive Lust, nämlich Beruhigung. Aufhebung von Vergnügen bereitet nicht geradezu Schmerz, sondern Gleichgültigkeit oder Betrübnis. Dem Ungeheuren und Gewaltigen wohnt ein ästhetischer Reiz inne, den wir als Erhabenheit bezeichnen, sobald wir nur die Vorstellung von Gefahr und Schmerz haben, ohne von solchen Zuständen bedroht zu sein. Das Gefühl des Erhabenen ist staunende Bewunderung und Ehrfurcht. Das Erhabene weckt also Lust durch Erregung des Selbsterhaltungstriebes ohne ernstliche Gefahr für die Selbsterhaltung. Dagegen sind alle Eigenschaften der Dinge, die uns lusterfüllte Gesinnung des Wohlwollens, der Zärtlichkeit und ähnlicher Neigung des Geselligkeitstriebes einflößen, schön. Nicht die egoistischen sondern die sympathischen Triebe werden hier angeregt, jene Triebe, die an Freundschaft, Umgang und Unterhaltung Befriedigung und Vergnügen finden, die sich an den sanften Reizungen aller Sinne entflammen. Darum erscheint auch dem erregten Fortpflanzungstriebe das andere Geschlecht schön. Was klein, zart, glatt, weich, rund, rein, glänzend, farbensatt ist, wirkt schön, eben weil es in uns
jene sanfte Bewegtheit der Sinne und der Sympathie hervorruft. Zwischen Erhabenheit und Schönheit gibt es noch eine Mittelgattung: Schönheit an Gegenständen größerer Ausdehnung, die Pracht ist. An diese Analyse schließt sich ein Versuch, die psychologischen Begleiterscheinungen zu beschreiben. Die Erschütterung, in die uns Erhabenheit versetzt, reinigt die Gefäße von beschwerlichen Verstopfungen und erregt dadurch eine Art wohlgefälligen Schauers. Schönheit bewirkt ein Nachlassen aller gespannten Teile, eine Empfindung von süßer Ermattung. Lessing und Kant haben diesen Versuch Burkes warm anerkannt. Lessing trug sich mit der Absicht, Burkes Schrift ins Deutsche zu übersetzen und mit eigenen Zusätzen zu versehen.
Das ästhetische Werk Henry Hornes hat Dilthey mit Recht als die reifste und vollständigste Untersuchung des 18. Jahrhunderts über das Schöne bezeichnet. Seine Elements of criticism veröffentlichte dieser Freund David Humes 1762. Das Werk beginnt mit einer Unterscheidung höherer und niederer Sinne. Gesichts- und Gehörseindrücke sind feiner, seelischer als Geruchs-, Geschmacks- und Tastempfindungen. Ihre Ergötzungen stehen zwischen denen des Verstandes und denen der niederen Sinne - maßvoll und sanft anregend üben sie heilsamen Einfluß. Die schönen Künste schaffen ihnen besondere Reize. Die Empfänglichkeit dafür, der Geschmack ist der Pflege und Vervollkommnung fähig und bedürftig. Die Wissenschaft einer rationalen Kritik ist nur dazu da, die Grundsätze zu entwickeln, nach denen wir Geschmacksurteile fällen und damit die Grundursachen der schönen Künste zu entdecken. Diese Regeln müssen der menschlichen Natur entnommen werden. Hierbei muß man von Erfahrungen stufenweise zu den Grundsätzen aufsteigen. – Die Seele hat eine Tendenz, Vorstellungen in natürlicher Ordnung zu verfolgen. Sie fällt mit dem schweren Körper, fließt mit dem Flusse, steigt auf mit Feuer und Rauch. An solcher Ordnung, solchem Zusammenhang finden wir Ver- gnügen. Sobald wir gegen die Ordnung den Vorstellungs-
verlauf herstellen wollen, empfinden wir eine unangenehme Art von rückläufiger Bewegung. Jedes Werk der Kunst, das sich dem natürlichen Verlauf unserer Vorstellungen gemäß verhält, ist insofern angenehm. Darum müssen seine einzelnen Teile untereinander und mit dem Ganzen in gehöriger Verbindung stehen. Wesentliche Teile müssen mit dem Ganzen in innigere Verbindung gesetzt werden als unwesentliche Episoden; was besonders für den epischen Dichter gilt. – Nach den Gesetzen der Assoziation macht ein Gegenstand, der uns angenehm ist, auch jedes Ding, das innig mit ihm verbunden werden kann, angenehm. Darum übertragen wir die Wertschätzung, die wir ausgezeichneten Männern widmen, so leicht auf ihre zufälligen Eigenschaften und Handlungen und suchen sie nachzuahmen. Der Wert kann aber nur vom Wesentlichen auf das Zufällige und nicht umgekehrt übertragen werden. Ein schöner Handschuh macht die Person, die ihn trägt, noch nicht schön. Die Gemütserregungen knüpfen sich nicht nur an die wahrnehmbare Gegenwart eines Vorganges oder Gegenstandes, sondern auch an deren ideale Gegenwart. Diese ist eine wirkliche Vergegenwärtigung früherer Erlebnisse, mehr als eine flüchtige Erinnerung; sie ist gewissermaßen ein Traum im Wachzustande. In dieser idealen Vergegenwärtigung gibt es viele Grade der Lebhaftigkeit, durch die sie sich teils der Wahrnehmung, teils der reflektierenden Erinnerung annähern kann. Diese Grade der Lebhaftigkeit hängen mit von der Intensität der erregten Emotionen ab. Die Lebhaftigkeit der idealen Gegenwart hängt nicht von dem Nachdenken über Wahrheit oder Erdichtung ab, weil die ideale Gegenwart selbst nicht davon abhängig ist, sobald sie einmal zustande gekommen ist. Eine Theateraufführung kann uns am stärksten den Eindruck idealer Gegenwart hervorzaubern; ihr zunächst steht das Gemälde, am schwächsten wirkt die Lektüre. Dafür ist die Malerei auf die Darstellung eines Augenblicks eingeschränkt, während die Dichtung Handlung, Begebenheit und Entwicklung in der Zeit glaubhaft ver-
gegenwärtigt. Dieser Gedankengang steht einem bekannten Lessingischen sehr nahe. Lebhafte ideale Gegenwart wird vor allem da entstehen, wo ein organischer Zusammenhang alle Einzelheiten sorgfältig verknüpft; ein unglaubhaftes Ingrediens reißt uns aus der Verzauberung, die uns gefangen hielt. – Treffen Emotionen aus verschiedenen Ursachen zugleich in der Seele zusammen, so verstärken sich die gleichartigen, während etwa Fröhlichkeit und Trauer sich nicht vereinigen. Gleichzeitige Erregung verschiedener Sinne durch eine Landschaft voll Blumenduft und Vogelgesang verstärkt den Gesamteindruck über die Wirkung jeder Einzelheit hinaus. Eine Harmonie der Emotionen zeigt sich vornehmlich da, wo Ursachen von größerer Verschiedenheit gleichartige Emotionen erregen. Viele Emotionen haben eine eigentümliche Ähnlichkeit mit ihren Ursachen; eine träge Bewegung stimmt uns selbst matt und unlustig. – In dem Streit der Geschmacksurteile kann wissenschaftlich nur entscheiden wollen, wer von der gleichartigen und gemeinschaftlichen Veranlagung der menschlichen Gattung überzeugt ist. Jeder hält zunächst sein Geschmacksurteil für übereinstimmend mit den allgemeinen menschlichen Urteilsgrundlagen; und tatsächlich spürt auch eine rohere Natur etwas von reinerem, menschlicheren Verhalten. Selbst wenn sie eigentlich nur an niederen Vergnügungen Geschmack findet, gesteht sie doch oft, der künstlerische Geschmack sei der edlere. Wir werden also die wahren Regeln des Geschmacks nicht bei den Wilden suchen, sondern bei den verfeinerten Nationen, und auch dort werden wir uns an erfahrene und nachdenkliche Menschen von gereifter Erziehung wenden. – Bei Gegenständen des Gesichts und des Gehörs unterscheiden wir deutlich deren angenehme oder unangenehme Beschaffenheit von den Gefühlen der Lust oder Unlust, die sie in uns erregen. Bei den anderen Sinnen verwischt sich dieser Unterschied. Eine angenehme Erscheinung des Gegenstandes nennen wir Schönheit, eine unangenehme Häßlichkeit. Ist nun die Schönheit, die wir den
Dingen zuschreiben, eine primäre oder eine sekundäre Eigenschaft? Schönheit ohne jemanden, der sich ihrer freut, können wir uns gar nicht vorstellen. Auch kann, was einem schön erscheint, einem anderen häßlich vorkommen. Sie ist demnach eine sekundäre Qualität, aber wie alle sekundären Qualitäten auch vom Gegenstande abhängig. Aus der Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt entsteht die Lust an der Schönheit, die als liebliche Heiterkeit gekennzeichnet wird. – Schön erscheinen uns schon gewisse Elemente, die in ihrer Zusammensetzung gesteigerten Eindruck machen. Die lebhafte und glänzende Farbe von Silber und Gold trägt zu dem hohen Werte bei, den wir diesen Metallen beilegen. Schönheit der Gestalt entspringt aus Einförmigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnung. Diese Momente erleichtern die Vorstellung von Gegenständen. Im Gegensatz zu Hutcheson findet Horne ein Quadrat schöner als ein reguläres Sechseck, weil sich bei letzterem die Aufmerksamkeit mehr zersplittere, die Auffassung erschwere. Eines Rechtecks Schönheit beruht auf dem Verhältnis der Seiten; sind diese voneinander zu wenig verschieden, so sieht das Rechteck wie ein mißratenes Quadrat aus. Zu Kunst. Doch taugt das Prinzip der Einheit in der Mannigfaltig verwirrt und verhindert einen nachhaltigen Eindruck. Auf einem Gemälde, wo ein Gegenstand den Beschauer besonders stark einnimmt, stören allzu mannigfache Zierate. In der Natur vertragen wir größere Mannigfaltigkeit als in der Kunst. Doch taugt das Prinzip der Einheit in der Mannigfaltigkeit nicht allein zum ästhetischen Grundprinzip, es müssen die Forderungen, die oben aufgestellt wurden, mitberücksichtigt werden. Einheit in der Mannigfaltigkeit gibt es auch an häßlichen Dingen. – Größe allein macht auch noch keine Erhabenheit. Dazu gehört Regelmäßigkeit, Ordnung oder sonst Merkmale der Schönheit. Ein erhabener Gegenstand beschäftigt die ganze Aufmerksamkeit und erfüllt die Seele mit starken Stimmungen, die mehr ernsthaft als fröhlich sind. Die Merkmale der Schönheit bauen zwar den Eindruck
der Erhabenheit mit auf, finden aber keine große Sonderbeachtung und treten im Eindruck nicht so deutlich erkennbar hervor. Gegenstände, die ähnliche Emotionen hervorrufen wie erhabene Gegenstände, Edelmut etwa, nennen wir nach dem Prinzip der Wertübertragung gleichfalls erhaben. Ein Kunstwerk wird nicht erhaben wirken, wenn die Darstellung sich in Einzelheiten verliert. Demut und Ehrfurcht sind mittelbare Wirkungen des Erhabenen. Anmut und Würde nimmt Horne als ausschließliche ästhetische Attribute des Menschen in Anspruch. Anmut ist der Ausdruck einer schönen Seele, Würde Ausdruck einer erhabenen Gesinnung. Horne unterscheidet verschönernde Künste, wie Gartenbaukunst, nachahmende wie Plastik und Malerei, schöpferische wie Architektur, Dichtung und Musik. Der größte Teil des zweiten Bandes enthält eine Poetik.
Ein eigenartiger Vertreter der assoziationspsychologischen Ästhetik ist Arch. Alison mit seinen Essays on the nature and principles of taste (1790). Ästhetischer Genuß ist nach ihm nur da möglich, wo die erregte Phantasie in freiem Spiel den ursprünglichen Eindruck bereichert, und zwar müssen die so durch einen assoziativen Faktor bereicherten Vorstellungen Stimmungen des Gemüts erwecken. Die herbeiströmenden Emotionsideen müssen sich alle einer beherrschenden Grundstimmung einfügen. Mit seiner konsequenten Durchführung dieser Ansicht hat sich Alison einen Platz in der Geschichte des Begriffs vom „assoziativen Faktor“ gesichert. Er ist der Vorläufer der zahlreichen Ästhetiker geworden, die nur in der spielenden, denkenden, ergänzenden Phantasietätigkeit den Grund für die eigentümlich ästhetischen Wirkungen eines Gegenstandes erblicken. Daneben ist er bemüht gewesen, besondere Merkmale ausfindig zu machen, die Reproduktionen als ästhetisch charakterisieren. Gerade dieses Bestreben, das auch Horne teilt, zeichnet diese englischen Ästhetiker vor ihren Vorgängern in bemerkenswerter Weise aus und bedeutet grundsätzlich den Abschluß für die Lehre vom assoziativen Faktor. Beide,
Home sowohl wie Alison, sehen den ästhetischen Wert des letzteren in einem gewissen Zusammenhang der reproduzierten Vorstellungen. Das Verdienst dieser Versuche kann unsere historische Skizze nicht besser ans Licht stellen als durch die Erklärung, daß selbst Fechner in dieser Hinsicht hinter ihnen zurückgeblieben ist.
Literatur.
v. Stein, Die Entstehung der neueren
Ästhetik. Stuttgart 1886.
v. Dankelmann, Charles Batteux. Rostock
1902.
Wohlgemuth, Hornes Ästhetik. Rostock 1894.
Neumann,
Die Bedeutung Hornes für die Ästhetik. Halle (Diss.)
1894.
Fowler,
Shaftesbury and Hutcheson. London 1882. Scott, Francis Hutcheson.
Cambridge 1900.
Lotze,
Geschichte der Ästhetik in Deutschland. München 1868.
Sommer, Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie
und Ästhetik.
Würzburg 1892.
v. Hartmann, Die deutsche
Ästhetik seit Kant. Berlin 1886.
Diese Untersuchungen können unmittelbar zur modernen empirischen Ästhetik hinüberleiten, für die sie einen weit fruchtbareren Ausgangspunkt bilden als Kant und die nachkantische deutsche Ästhetik. Schon Kants Interesse ist vorwiegend auf die Frage nach Prinzipien a priori gerichtet. Bei Schiller, Schelling, Hegel und Schopenhauer treten spekulativ-metaphysische Gesichtspunkte immer mehr in den Vordergrund. Wie im Neoplatonismus fällt die Ästhetik hier ganz in den Bann der Metaphysik zurück; von einer selbständigen Wertung der ästhetischen Objekte ist daher nicht mehr die Rede. In der romantischen Ästhetik kehrt die spätantike Lehre von der Beseelung, vom inneren Leben, vom unmittelbaren Ausdruck der Idee wieder, deren Prinzipien wir dort begegnet sind. Schließlich ist die Fülle des Stoffes dieser metaphysischen Ästhetik zu reich; in unserem einleitenden Überblick müßte eine Auseinandersetzung mit all diesen Systemen allzu fragmentarisch ausfallen. Mit Fechner bricht ein neuer Strom empirischen Forschens herein.
Fechner, der Begründer der experimentellen Psychologie ist auch zum Begründer der experimentellen Ästhetik geworden. Er stellt einander gegenüber eine Ästhetik von oben und eine Ästhetik von unten und betrachtet letztere, die empirische Ästhetik, als notwendige Vorstufe zur ersteren, der philosophischen Ästhetik. Im weitesten Sinne heißt ihm schön alles, was unmittelbar gefällt, im engeren (ästhetischen) Sinne nur, sofern es höhere als bloß sinnliche Lust unmittelbar aus Sinnlichem schöpfen läßt, im engsten Sinne schließlich, wenn es zugleich sittlich wertvolle Lust weckt. Mit einem Prinzip erklärt Fechner in der Ästhetik nicht ausreichen zu können. Er stellt zwei quantitative Prinzipien auf, erstens das der ästhetischen Schwelle, zweitens das der ästhetischen Hilfe. Oberster Formalprinzipien kennt er drei, deren erstes ist das Prinzip der einheitlichen Verknüpfung des Mannigfaltigen, ihr zweites das Prinzip der Klarheit, ein letztes das Prinzip der Wahrheit. Diese sind zugleich primäre qualitative Funktionszusammenhänge, Gesetze. Endlich dient ihm als sekundäres Prinzip das Assoziationsprinzip.
Das Prinzip der ästhetischen Schwelle besagt, daß die Lust und Unlustbedingungen ein gewisses Quantum erreichen müssen, um die Lust und Unlustschwelle zu überschreiten.
Das Prinzip der ästhetischen Hilfe besagt, daß aus dem widerspruchslosen Zusammentreffen von Lustbedingungen, die für sich wenig leisten, ein größeres Lustresultat hervorgeht, als dem Lustwerte der einzelnen Bedingungen für sich entspricht.
Das Prinzip der einheitlichen Verknüpfung des Mannigfaltigen muß erfüllt sein, wenn der Mensch an der rezeptiven Beschäftigung mit dem Gegenstande soll Gefallen finden können.
Nach dem Prinzip der Widerspruchslosigkeit, Einstimmigkeit oder Wahrheit gefällt es uns, wenn verschiedene Anlässe, dieselbe Sache vorzustellen, auf eine übereinstimmende
Vorstellung führen. Engelflügel müssen so gemalt werden, daß wir sie uns als wirkliche Mittel zum fliegen vorstellen.
Nach dem ästhetischen Assoziationsprinzip trägt die beim Anschauen einer Sache geweckte Erinnerung an Gefallendes oder Mißfallendes zum ästhetischen Eindruck der Sache bei. Darauf gründet sich die Unterscheidung des direkten und des assoziativen Faktors im ästhetischen Eindruck.
Niemand bezweifelt, daß Farben, Formen und Töne und selbst deren Verhältnisse uns unabhängig von Sinn, Bedeutung, Zweck, Erinnerung auf Grund direkter Einwirkung mehr oder weniger gefallen können. Diese direkte Wirkung beruht auf anschaulicher Einheit des Mannigfaltigen, auf Fülle und Reinheit der Töne, Glanz, Reinheit und Sättigung der Farben. Der assoziative Faktor kann die Gefälligkeit des direkten je nachdem steigern oder stören. In verschiedenen Künsten wirken die beiden Faktoren verschieden stark. Nach dem Prinzip der ästhetischen Hilfe steigern sich Wohlgefälligkeiten beider Faktoren. Vielfach läßt der assoziative Faktor einen Spielraum, innerhalb dessen der gefälligere direkte Faktor dem mißfälligeren vorgezogen wird. Zuweilen wird auch dem direkten Faktor ein Opfer gebracht. Es ist falsch, auf die Bedeutungslosigkeit des direkten Faktors zu schließen, weil er zumeist dem assoziativen untergeordnet wird.
Weiter hat fechner noch eine Reihe anderer Prinzipien aufgeführt, wie Kontrast, Übung, Gewöhnung.
Fechners Verdienst liegt nicht in der Systembildung, er hat empirisch wissenschaftliches Verfahren in der Ästhetik gefördert. Das führt einmal zur Anwendung des Experiments, dann zur Abstraktion einzelner Gesetze aus der Beobachtung des ästhetischen Verhaltens. Damit hat er die Bestrebungen der Engländer aus dem 18. Jahrhundert, namentlich Hornes wieder aufgenommen, die sehr zum Schaden der wissenschaftlichen Erkenntnis so ganz vernachlässigt geblieben waren. Die Ästhetik der Gegenwart hat die Aufgabe, den systematischen Gesichtspunkt mit dem einzel-
wissenschaftlichen zu verbinden. Fechner war sich wohl bewußt, erst die Anfangsgründe gelegt zu haben. Er hat einen Nachfolger auf diesem schwierigen Gebiet erwartet.
Literatur.
Zimmermann,
Geschichte der Ästhetik. Wien
1858.
Schasler, Kritische Geschichte der Ästhetik.
Berlin 1872.
Knight, The philosophie of Beautiful.
London 1895.
Saintsbury,
A history of criticism and literary taste in Europe. Edinbourgh und
London 1900.
Leveque,
La science du Beau. Paris 1862. Croce, Estetica. Bari 1908.
Die Ästhetik als Wissenschaft vom schönheitsempfänglichen Verhalten und seinen Gegenständen, von deren Wert und Wirkung ist eine primäre, eine Einzelwissenschaft. Daß man sie heute noch zur Philosophie zählt, ändert daran nichts und steht damit nicht im Widerspruch. Sie befindet sich in der Loslösung von der Vormundschaft der Mutter Philosophie, wie die Psychologie und die Soziologie auch, wie früher einmal die Naturforschung. Die Normen der Ästhetik machen diese Wissenschaft noch nicht zu einer philosophischen Wissenschaft; mit ihren Idealen und Prinzipien ragt freilich die Ästhetik schließlich in die Metaphysik hinein, aber das teilt sie mit so ausgesprochenen Einzelwissenschaften, wie Mechanik oder Staatsrecht.
Fragt man, ob die Ästhetik ausschließlich zu den phänomenologischen Wissenschaften, zu den Real- oder zu den Idealwissenschaften zu rechnen sei, so wäre zu antworten, daß sie an allen diesen Gesichtspunkten teilnehmen kann. Ihr Gegenstand läßt sich als bloßes Phänomen fassen, als eine Gegebenheit, der gegenüber Kriterien körperlicher oder geistiger Realität gar nicht angewandt zu werden brauchen. Wer in ein Kunstwerk versunken ist, scheidet nicht zwischen sich und dem Objekt. Wo aber dann das Ich und sein Gegenstand einander gegenübertreten, da geschieht das in naivvergegenständlichender Weise. Dies Erlebnis, so wie es wirklich ist, wird dann zum Gegenstand der ästhetischen Analyse. Eine Methode, die das Wesen des ästhetischen Erlebnisses vergegenwärtigen will, ohne auf die Einzelfälle seines psychischen Vollzugs zu achten, ist mit besonderem
Feinsinn von der Husserlschen Schule als phänomenologische ausgebildet worden.
Aber auch der realwissenschaftliche Gesichtspunkt kann angewandt werden. Eine Ästhetik, die sich seiner bedient, wird sich nicht zu den Naturwissenschaften zählen sondern zur Psychologie, also zu den Geisteswissenschaften. Das ästhetische Verhalten beruht zum großen Teil auf psychischen Faktoren, wie Vorstellungen, Gefühlen, Urteilen, Phantasie und unterliegt insofern der psychologischen Realisierung. Aber auch leibliche Erregung spielt herein; man denke nur an den Einfluß der Körperhaltung in manchem rezeptiven Verhalten. Hier erhält die Psychophysik das Wort.
Schließlich kann man auch die idealwissenschaftliche Betrachtungsart in der Ästhetik zur Geltung bringen. Dann wird ihr Gegenstand, wie wir sahen, ein ideales, vollentfaltetes ästhetisches Verhalten, wie es nur in seltenen Fällen verwirklicht wird. Zum Unterschiede von der Mathematik, die lediglich formale Bestimmungen vergegenständlicht, idealisiert solche Ästhetik materiale Bestimmungen. Dabei ist sie aber nicht wertindifferent, wie etwa die theoretische Physik. Blicken wir von hier zurück, so ergibt sich, daß alle einzelnen wissenschaftlichen Betrachtungsweisen in der Ästhetik anwendbar sind. Der Streit der Ansprüche erweist sich hiernach als Versuch, eine einzige von ihnen als ausschließlich verwertbare darzutun. Die Ästhetik ist nicht nur Phänomenologie, aber sie kann phänomenologisch behandelt werden. Sie ist nicht nur Psychologie, aber diese ist besonders mit ihren Methoden stark an ihrem Ausbau beteiligt. Sie ist nicht nur Wert- und Normwissenschaft, aber sie muß auch in dieser Richtung ausgebaut werden. Der psychologische Ästhetiker hat durchaus recht, wenn er die Berechtigung seiner Forschungsart verficht, auch der phänomenologische Ästhetiker kann dies beanspruchen. Um aber einen methodisch glücklichen Ausgangspunkt zu gewinnen und soviel systematische Geschlossenheit, wie zwanglos tunlich, zu erreichen, müssen wir aus der Analyse des ästhe-
tischen Verhaltens die drei dargetanen Gesichtspunkte ableiten.
Wenn wir die in der Literatur hervorgetretenen Betrachtungen über die Aufgaben der Ästhetik und ihre Stellung im System der Wissenschaften untersuchen, so finden wir folgendes geltend gemacht:
Die Ästhetik sei eine psychologische Wissenschaft; dahin gehörten ihre Gegenstände und Methoden. Das Schöne ist nach Segal in erster Linie ein Erlebnis und als solches Gegenstand der Psychologie. Die Eigentümlichkeit des ästhetischen Zustandes kann darum nur durch psychologische Analyse und einen Vergleich mit außerästhetischen Zuständen gefunden werden. Auch die Ursachen des ästhetischen Zustandes können nur psychologisch bestimmt werden. Die sogenannten ästhetischen Werte sind ihm nur Schätzungen subjektiver Art, aus psychologisch feststellbaren Wertungen, unserem Anerkennen und Verwerfen, unserem Gefallen und Mißfallen hervorgegangen. Allgemeingültige Normen, nach denen wir uns zu richten hätten, objektive Werte, die wir trotz unseres Mißfallens anzuerkennen hätten, gibt es nicht auf ästhetischem Gebiet. Schön ist, was gefällt, schöner, was vorgezogen wird. Normen sind bestenfalls psychische Naturgesetze, für das, was gesetzmäßig (Verschiedenen Verschiedenes) gefällt.
Alles, was hier hervorgehoben wird, zeigt doch nur, daß die Psychologie an der Ästhetik nicht unbeteiligt ist, aber nicht, daß sie schlechthin in Psychologie aufgeht. Sobald wir zwischen gutem und schlechtem Geschmack, zwischen grober und feiner Empfänglichkeit, zwischen richtigem und unrichtigem ästhetischen Urteil scheiden, überschreiten wir die Grenzen der Psychologie. Das Werten fällt gewiß hinein, aber nicht die Beurteilung des Ergebnisses einer solchen Wertung als eines richtigen oder unrichtigen. Nun kann man freilich dadurch einen Ausweg zu finden suchen, daß man von vornherein nur den Geschmack einer ästhetisch gebildeten Minderheit zum Ausgangspunkt für die psycho-
logisch-ästhetischen Untersuchungen macht. Aber damit wird das Problem nur zurückgeschoben. Um zu bestimmen, wer zu einer solchen Minderheit gehört, muß man doch schon eine Norm oder Wertskala zur Verfügung haben. Außerdem kann die Minderheit auch irren. So wichtig es ist, die wirklichen Wertungen kennen zu lernen, damit ist doch die ganze Aufgabe der Ästhetik noch nicht bezeichnet.
Daß die psychologische Ästhetik noch in anderer Richtung ihre Grenzen hat, ist namentlich von Meumann behauptet worden. Er weist auf die objektive Ästhetik hin, die von den Werken der Kunst und der schönen Natur ausgeht und sie im Sinne Sempers vergleichend-genetisch betrachtet. Zu dieser Richtung sind auch Cornelius, Volkmann, Waetzold, Voll zu rechnen. Einer vergleichend-ethnologischen Methode huldigen E. Grosse und Wundt. Schließlich ist Raum genug für eine kulturhistorische Würdigung. Unter ästhetischer Kultur versteht Meumann die geschmackvolle Durchbildung unserer gesamten Daseinsform; so erfaßt die ästhetische Kultur Körper und Kleidung, Haus und Garten, samt allem Werkzeug. Danach unterscheidet Meumann vier Aufgaben der Ästhetik: Einmal eine Psychologie des ästhetischen Genießens, sodann eine Psychologie des künstlerischen Schaffens, ferner die Theorie der Künste, schließlich eine Lehre von ästhetischer Kultur.
Zusammengefaßt werden diese Aufgaben in eine Lehre vom ästhetischen Verhalten, als eines eigenartigen Verhaltens von Menschen zur Welt, in eine Wissenschaft auch von den Produkten dieses Verhaltens. Wie man sieht, wird dadurch die Ästhetik als Geisteswissenschaft bestimmt, der die Psychologie eine Fülle von Tatsachen und Forschungsmitteln erschließt.
Aus den oben erwähnten Gründen gilt anderen Denkern die Ästhetik geradezu als Wertwissenschaft, die Normen aufstellt. Maßgebend wären diese Normen für das ästhetische Urteil (eben für eine besondere Art von Werturteilen), richtunggebend auch für das künstlerische Schaffen, das wert-
volle Werke wirken will. Sie machen geltend, daß eine streng psychologische Ästhetik ein Unding sei, da sie alle ästhetischen Urteile und Erzeugnisse als gleichwertig behandeln müßte. Sie weisen darauf hin, daß die ästhetischen Urteile selbst noch wieder bewertet werden müssen und nicht einfach als letzte Data hinzunehmen sind. Ebenso betonen sie, wie Naturschönheit und Kunstwerke von sehr verschiedenem ästhetischen Wert sind. Mögen diese Werte auch dem entwicklungsfähigen Kulturmenschen erst mit der Zeit aufgehen, so ändert das nichts an der Aufgabe, die üblichen Schätzungen auf letzte Normen zurückzuführen. Einen solchen Wertmaßstab sucht Volkelt in den Grundbedürfnissen der menschlichen Natur. Er glaubt davon folgende ausmachen zu können: wir verlangen nach gefühlerfülltem Anschauen, nach Ausweitung unseres fühlenden Vorstellens, nach Herabsetzung des Wirklichkeitsgefühls. Freilich scheint mir damit nicht viel gewonnen zu sein. Diese Angaben sind zu unbestimmt und lassen ganz verschiedene Urteile über denselben Eindruck als gleichberechtigt erscheinen. Was dem Einen gefühlerfüllte Anschauung vermittelt, läßt den Anderen ganz kalt. Mit solchen Normen haben wir kein Mittel gewonnen, um die verschiedenen Urteile über dieselben Werke selbst wieder bewerten zu können.
Ein anderer Weg, um Normen zu begründen, ist die Analyse der tatsächlichen Werturteile, die über Kunstwerke gefällt werden. Dabei wählt man zweckmäßig vielfach anerkannte, sorgfältig begründete, auf genauer Beobachtung beruhende Werturteile, wie sie in den Kritiken von Berufenen vorliegen. Damit ist noch nichts über die Richtigkeit ihrer Urteile ausgemacht; aber es entspricht einer verständigen Gewohnheit, sich mehr an die Urteile geübter Sachverständiger zu halten, als an die beliebige Meinung unerfahrener Laien. Die vergleichende Analyse solcher Kritiken ist leider noch fast gar nicht in Angriff genommen worden. Man wird an Schillers Besprechung des Egmont denken und
sich fragen, ob in anderen Kritiken großer Rezensenten gleiche Prinzipien vorausgesetzt werden.
Auch ein anderes Verfahren der Normergründung, die Analyse hervorragender Kunstwerke, ist noch wenig angewandt worden. Hier müßte es gleichfalls möglich sein, durch vergleichende Analyse gewisse letzte Prinzipien aufzufinden und Werte, die von den Künstlern realisiert worden sind.
Die ästhetischen Objekte sind uns um ihrer selbst willen wert. Ihr Eigenwert wird im ästhetischen Verhalten auf sie gelegt, wo empfängliches Interesse und Gefallen sich ihrer merklichen Beschaffenheit zuwendet. Sicher hat solche Wcrtung sich einmal entwickelt. Was uns anfangs Fremdwert war, ist schließlich Eigenwert für uns geworden. Dem ästhetisch Unerzogenen ist heute noch die Nebenwirkung der schönen Dinge wert; er sucht im Roman Unterhaltung, Belehrung, im Theater die Ausspannung. Wir aber messen den ästhetischen Gegenständen unbedingten Wert zu. Das bedeutet: wir bezeichnen einen solchen Gegenstand als absolut wertvoll, sofern er das ideale ästhetische Verhalten befriedigt. Alle anderen Verhaltungsweisen sind dann unmaßgeblich. Die frage freilich ist, ob es ein einziges ideales Verhalten gibt, oder ob nicht vielmehr individuelle Verwirklichungen verschiedener Spielart anerkannt werden müssen.
Andere Denker neigen hingegen zu der Meinung: Weil die Schönheit ein Wert ist, darum wird sie erstrebt; sie hat nicht dadurch einen Wert, daß sie erstrebt wird. Weil das Kunstwerk schön ist, gefällt es; es ist nicht schön, weil es gefällt. Der Wert ginge so der subjektiven Anerkennung voraus. Ein solcher Wert kann aber nur metaphysisch erklärt werden. Die bloße Tatsache, daß solche Werte anerkannt und verehrt werden, reicht nicht aus, um ihre Objektivität sicher zu stellen. Metaphysische Zurückführung auf ein absolutes Subjekt sollte aber nur da versucht werden, wo alle anderen Deutungsversuche versagen. Auf dem Gebiete der Ästhetik ist es mißlich, daß es kaum einen Gegen-
stand geben dürfte, der nicht dem mißfallen, jenem gefallen kann, ohne daß man die Urteilsabweichung immer auf Unachtsamkeit, Verständnislosigkeit und Stumpfheit zurückführen kann. Nur die Erfahrung kann zeigen, wieweit prinzipiell konstante Gegenstandsbeschaffenheiten bestehen, denen positive oder negative Wertungen stets entsprechen. Denn wenn Objekte überhaupt als Bedingungen der Wertung gelten sollen, dann müssen gleiche Bedingungen gleichen Einfluß üben. Dann aber reicht unsere Erklärung des vollkommenen und reinen idealen Verhaltens als Wertquelle aus. Wir können uns dazu verstehen, der Schönheit einen objektiven Wert zuzuschreiben. Wir binden ihn an objektive Korrelate idealer positiver Wertungen, deren potenzieller Wert nicht verloren geht, wenn sie einmal ohne empfängliche Betrachter sind.
Wenn so in der Ästhetik die Gesichtspunkte der Wertwisscnschaft an ihrem Orte mit Sinn angewandt werden, so braucht die Ästhetik doch nicht von vornherein absolute Werte und allgemeingültige Wertungen vorauszusetzen. Es genügen hypothetische Bestimmungen über den ästhetischen Wert und das wertende Verhalten. Innerhalb dieser Grenzen ist Allgemeingültigkeit möglich. Die Voraussetzung eines idealen ästhetischen Verhaltens ist dazu wichtigste Bedingung.
Literatur.
Segal,
Über die Wohlgefälligkeit einfacher
räumlicher Formen. Archiv für die gesamte
Psychologie, Bd. 7, S. 53 ff.
Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten.
Zwei Bände. Frankfurt 1860/63.
Cornelius,
Elementargesetze der bildenden Kunst. Leipzig 1908.
Volkmann, Die Erziehung zum Sehen und andere Zeitgedanken zur
Kunst.
Leipzig 1912.
Waetzold,
Einführung in die bildenden Künste. Leipzig 1912.
Voll, Entwicklungsgeschichte der Malerei. 2 Bde. München
1913/14.
Grosse, Kunstwissenschaftliche Studien. Tübingen
1900.
Volkelt, Die entwicklungsgeschichtliche Betrachtungsweise in der
Ästhetik. Zeitschrift für Psychologie. Bd. 29, S. 1ff.
Wundt,
Über Wege und Ziele der Völkerpsychologie. Leipzig
1886.
Erfahrungen und Beobachtungen zur unmittelbaren Feststellung des ästhetischen Verhaltens führen dessen Untersuchung zunächst zu den subjektiven Methoden der Psychologie. Diese Wissenschaft hat sich erst erfolgreicher entfaltet, seit sie empirisch, d.h. mit induktiven Verfahren aufbaut. Die Ästhetik beginnt in ihrem psychologischen Teil mit Beobachtungen. Die Beobachtungen richten sich auf das determinierte ästhetische Verhalten. Dessen Störungen oder Herabsetzungen bleiben für die Ästhetik außer Betracht. Die qualitative Aufgabe ist dabei, Beschreibung der im ästhetischen Verhalten gegebenen Erscheinungen, eine quantitative Aufgabe die Untersuchung des Einflusses, der den einzelnen Elementarerscheinungen für die Gesamtverfassung und für die ästhetische Wirkung zukommt. Nun wäre unsere Forschung sehr beschränkt, wenn sie lediglich auf zufällige und gelegentliche Beobachtungen gegründet wäre, wenn sie sich gar mit den Erlebnissen des untersuchenden Ästhetikers begnügte. Wir dürfen es nicht einfach dem Lauf der Dinge überlassen, ob er uns Gegenstände der Beobachtung über den Weg führen wird. über Zufälligkeit und Individualität der Ergebnisse kann man zunächst dadurch hinauskommen, daß man Beobachtungen sammelt. Als die Dresdner und die Darmstädter Madonna von Holbein zusammen ausgestellt waren und die Echtheitsfrage aufgeworfen wurde, legte Fechner ein Buch aus und ließ die Besucher über beide Werke ihr Urteil einzeichnen. So sammelte er vergleichbare Beobachtungen. Mary Calkins legte 450 Versuchspersonen verschiedenen Alters drei Bilder
vor, die gewisse charakteristische Unterschiede zeigten. Das eine war durch Färbung ausgezeichnet, das zweite durch zeichnerische Form und Umriß, das dritte durch seinen Ausdruck. Sie sammelte die Vorzugsurteile und berechnete sie statistisch. Dabei ergab sich z.B., daß Kinder von sechs Jahren in 88% aller Fälle dem farbigen, Erwachsene in 60% der Fälle dem formschönen Bilde den Vorzug gaben.
Über das Sammeln von Beobachtungen erhebt sich die experimentelle Methode dadurch, daß sie das Material von seiner zufälligen Beschaffenheit unabhängig macht und darum schon bei der Beobachtung selbst viel zuverlässiger und kritischer vorgeht. Das Material wird nach verschiedenen Gesichtspunkten variiert und gesichtet, die Versuchspersonen werden gewählt, geschult und kontrolliert. Dabei gibt es zwei Formen des Experiments, ein inneres und ein äußeres. Willkürlich hergestellt und variiert werden können ästhetische Eindrücke zunächst in der Phantasie. Man kann sich beliebige Raumformen, Konfigurationen und Elemente davon vorstellen, sie als mehr oder minder gefällig und wertvoll beurteilen. Dies innere Experiment übt wohl gelegentlich einmal ein Künstler, der Einfälle prüfend vergleicht. Auch der Ästhetiker kann der Phantasie nicht entraten; er muß sich, so gut es gehen will, in die Seele empfänglicher Menschen, wohl auch schaffender Künstler hineinversetzen. Das äußere Experiment hat den Vorteil, von der Vorstellungsfähigkeit unabhängig zu machen, die ja individuell sehr verschieden ausgeprägt ist. Nach einigen Anfängen in der englischen Ästhetik des 18. Jahrhunderts hat es Fechner zuerst mit vollem Bewußtsein der Tragweite durchgeführt.
Alle bisher bewährten experimentellen Methoden arbeiten mit der relativen Bevorzugung oder Zurücksetzung von Eindrücken, die zur Wahl stehen. Eindrucksmethoden zur Untersuchung des empfänglichen Verhaltens verwenden teils konstante teils variable Eindrücke. Konstante Eindrücke erlauben Methoden der einfachen und mehrfachen Wahl, die Reihenmethode, die Methode der paarweisen Vergleichung. Die Varia-
tion der Eindrücke kann kontinuierlich oder diskret ändern; sie kann endlich Zeitvariation sein. Die von ferne auf das aktive ästhetische Verhalten gerichteten Herstellungsmethoden lassen unter bestimmten ästhetischen Gesichtspunkten Eindrücke aus gegebenen Elementen frei erzeugen. Die Ausdrucksmethoden registrieren die unter dem Einfluß des ästhetischen Verhaltens auftretenden Bewegungserscheinungen, Puls und Atmung. Fechner hat drei Methoden vorgeschlagen: Wahl, Herstellung und Verwendung; eigentlich experimentelle Methoden sind aber nur die ersten beiden, weil sie eine willkürliche Variation zulassen. Die Methode der Wahl hat Witmer vervollkommnet, von mir ist die Reihenmethode hinzugesellt worden. Cohn hat, wie vor ihm schon Witmer, paarweise vergleichen lassen. Martin hat die Methode der kontinuierlichen Änderung eingeführt, ich die Zeitvariation. Alle diese Methoden haben in relativer Wertordnung das Gefälligere dem weniger Gefälligen gegenübergestellt; unbestimmt bleibt es, inwiefern sich absolutes Wohlgefallen oder Mißfallen daran knüpft. In neuester Zeit hat man sogar eine absolute Wertskala einzuführen versucht (Major, Martin, Segal, Baker). Man empfahl den Versuchspersonen die Werturteile: sehr, mäßig, eben gefällig; indifferent; eben, mäßig, sehr mißfällig. Diese scheinbar absolute Wertbestimmung ist tatsächlich auch nur relativ; sie hat nur Geltung für die augenblickliche Stimmung, für die gegebenen Objekte. Streng durchgeführt reißt sie die Objekte aus dem Zusammenhang und macht dadurch gerade die Vergleichbarkeit aller Glieder einer Reihe, den Vorteil der Methode illusorisch.
Die Methoden der Herstellung und der einfachen Wahl sind insofern am einfachsten, als sie nur einen Wert ergeben. Dieser wird entweder aus gegebenen Elementen willkürlich hervorgebracht, oder aus einer Anzahl ähnlicher Objekte ausgesucht. Man kann z.B. den gefälligsten Rhythmus, die gefälligste Form eines Kreuzes, eines Rechtecks, die gefälligste Farbenkombination, das gefälligste Tonintervall herstellen; wenn man nur einen geeigneten Apparat zur stetigen
Veränderung der gebrauchten Elemente zur Verfügung hat. Andere Werte außer dem gefälligsten lassen sich nach diesen Methoden schwerlich gewinnen. Sobald man, wie Fechner, viele Versuchspersonen an derselben Reihe wählen läßt, erhält man durch Verteilung der Werte eine Art von Maß für die durchschnittliche Gefälligkeit. Dabei bleibt es aber fraglich, wie die Nebenwerte zu qualifizieren sind. Die Methode der Wahl ist jedenfalls auf die Fälle beschränkt, wo die ganze Reihe auf einmal dargeboten werden kann, wie beim Gesichtssinn. Ein Versuch zu besserer Ausnützung der Wahlmethode ist die Reihenmethode. War die Reihe der Wahlobjekte anfangs nach irgend welchen objektiven Gesichtspunkten geordnet, so verlangt die Versuchsaufgabe, sie nun in eine Wertreihe umzuwandeln. Diese hat dann lediglich relative Bedeutung. Trotz des Wechsels der absoluten Gemütslage kann die relative Stellung der einzelnen Glieder in der Wertreihe erhalten bleiben. Die Reihenmethode ist am besten als eine sukzessive, die ganze Reihe hindurch fortgesetzte Methode der Wahl zu behandeln. Auf Grund ihrer Ergebnisse lassen sich Kurven konstruieren, die alle Werturteile nach willkürlicher Skala den Größenverhältnissen zuordnen. Die Methode, paarweise zu vergleichen, beruht auf der Gegenüberstellung von nur zwei miteinander gefühlswertig vergleichbaren Objekten. Insbesondere die ästhetische Prüfung von Farbenkombinationen drängte zu diesem Verfahren, weil in einer umfassenderen Reihe die einzelnen Glieder einander mannigfach beeinflussen würden. Jedes Glied muß mit jedem anderen verglichen werden, was eine übergroße Anzahl von Kombinationen erheischt. Ersichtlich ist diese Methode umständlicher als die Reihenmethode und bei einer größeren Anzahl von Elementen nicht mehr durchführbar.
Meine Methode der zeitlichen Variation versucht, ästhetische Eindrücke von zeitlich begrenzter Dauer einwirken zu lassen. Mit einem Projektionsapparat werden Bilder auf einem Schirm entworfen. Die Versuchsperson sitzt im
Dunkelzimmer. Die begrenzte Dauer der Exposition wird durch einen photographischen Momentverschluß hergestellt. Der Gedanke, von dem diese Methode ausgeht, ist die Tatsache, daß ästhetisches Verhalten Zeit braucht, um sich in seinen einzelnen Phasen entwickeln zu können. Man kann daher diese Stadien isolieren, wenn man den Eindruck 1, 2, mehrere Sekunden lang enthüllt. Hier lassen sich komplexe Kunstwerke verwenden; man kommt dadurch dem wirklichen ästhetischen Verhalten näher. Voraussetzung für die Benutzbarkeit dieser Methode ist die Erlesenheit der Versuchspersonen, ihre Fähigkeit zu treuen, zuverlässigen und reichen Angaben über ihre Erlebnisse und Beobachtungen. Man kann so eine unmittelbare ästhetische Wirkung von einer mittelbaren scheiden und ausmachen, welchem ästhetischen Typus die Versuchspersonen angehören.
Welche Methode die beste ist, läßt sich a priori nicht sagen; das läßt sich nur in Vorversuchen erfahren. Die Schwierigkeit bei all diesen Experimenten liegt im Hineinspielen des assoziativen Faktors. Bei Rechtecken reproduziert man die Vorstellung von Visitenkarten oder Bücherformaten. Das Gefallen und Mißfallen an solchen Vorstellungen bestimmt aber das Urteil mit. Eine besondere Methode zur exakten Untersuchung der mittelbaren ästhetischen Wirkung gibt es noch nicht; es fehlt hier sehr an genaueren Bestimmungen. Um so mehr ist die Differenzierung der Aufgaben vonnöten; dazu aber verfeinerte Selbstbeobachtung, damit festgestellt werden kann, welche Gesichtspunkte für das Urteil maßgebend waren. Es muß aufgezeichnet werden, ob eine Erinnerung an bekannte Gegenstände oder ein Wissen von solchen mitgewirkt hat, ob einem der Gegenstand wert war, dessen man sich erinnert hat. Man muß erfahren, ob das Gefallen etwa an einer Farbe einen Umweg über eine Stimmung gemacht hat. Trompetenschall kann einem Soldaten gefallen. Zeichen, Farben und Formen können als Symbole gewirkt haben. Auch über die Einwirkung sympathischer Einfühlung auf das Urteil kann nur die Selbstbeobachtung
Auskunft geben. Große Aussichten hat vielleicht eine Methode, die einfache Gegenstände experimentell mit komplexen Werken vergleicht.
Die vergleichende Methode ergänzt die experimentelle da, wo es sich um komplexe Gegenstände handelt, die sich nicht mit experimentellen Mitteln variieren lassen. Man vergleicht etwa die musikalischen Vertonungen desselben Gedichts, man legt nebeneinander Zelters, Schuberts und Löwes Komposition des Erlkönigs. Ludwig Volkmann hat Kunstwerk und Naturobjekt miteinander verglichen. Diese vergleichende Methode kann nicht so sehr über Gefallen oder Mißfallen Aufschluß geben, als vielmehr über das Verhältnis der einzelnen Faktoren des ästhetischen Eindrucks zueinander, über die Zusammenhänge von Form und Gehalt, von Ausdruck und Darstellungsmittel. Aber nicht nur die Gegenstände können dieser vergleichenden Methode unterworfen werden sondern auch Urteile. Man läßt über dasselbe Objekt zu verschiedenen Zeiten urteilen und prüft, worauf der Unterschied im Verhalten beruht. Einmal wird der Zustand als konstant vorausgesetzt, einmal das Objekt. Die systematische Durchführung dieser objektiven Methode verspricht sehr wichtige Ergänzungen zu den subjektiven Methoden. Sie faßt die Urteile und Gegenstände als Äußerungen des ästhetischen Verhaltens auf, um von ihnen auf ihren Ursprung im Erlebnis zu schließen und so die gesetzmäßigen Zusammenhänge nachzuweisen, die zwischen den Bestandteilen der Objekte und den Zuständen obwalten, zwischen Absicht und Ausführung, Material und Gestaltung.
Aber wir können uns nicht auf diese objektive Methode allein verlassen. Sie kann nicht, wie die experimentellen Verfahren, Reihen vergleichbarer Gegenstände willkürlich herstellen. Sie kann nicht einzelne Momente eliminieren, gewisse Linien aus vergleichbaren Gestalten künstlich streichen. Sie kann nicht variable Momente stufenweise ändern, nicht verzerren und verzeichnen, wo es erwünscht ist, nicht, Klänge verfärben, wo das Aufschluß verspricht.
Von einer historischen Methode hat Dilthey geredet; doch kann das nicht im eigentlichen Sinne verstanden werden, da die historische Untersuchung an sich nichts über die ästhetische Bedeutung eines Tatbestandes entscheidet. Gewiß hilft sie zur Ergänzung des Materials, sonst aber hat die Kunstgeschichte Aufgaben und Methoden außerhalb der Ästhetik, die ihrerseits Hilfsdienste der Nachbarwissenschaft nicht versagt. Die Richtung, die Taine und Grosse eingeschlagen haben, um durch eine vergleichende Betrachtung der Kunstentwicklung über Wesen und Bedingungen der Kunst ins Klare zu kommen, ist nicht historische Methode, sondern eben vergleichendes Verfahren in unserem Sinne, ermöglicht durch die Ergebnisse der Kunstgeschichte. Aussagen der Künstler vergangener Zeiten über ihr Schaffen, die so wertvoll sind, überliefert der Geschichtsforscher treulich, der Ästhetiker aber erschließt sie dem Verständnis mit psychologischer Methodik.
Auch eine genetische Methode, die eine Entwicklungsgeschichte des ästhetischen Verhaltens schreiben will, kann nur ausgebaut werden, wenn mit den anderen Methoden der Ästhetik vorgearbeitet worden ist. Ob bei den Tieren Spuren ästhetischen Verhaltens vorliegen, und wie es sich bei Naturmenschen und Kindern damit verhält, werden wir erst dann erkennen und würdigen können, wenn wir bereits das voll ausgebildete ästhetische Verhalten bei uns selbst nach seinen Möglichkeiten und Formen kennen gelernt haben. Man kann nicht einfach die Methoden der physiologischen Entwicklungsgeschichte nachahmen.
Ein deduktives Verfahren ist keine Methode der Forschung, sondern eine Methode der Darstellung gesicherter Ergebnisse. Ihr strebt jede Wissenschaft zu, weil nur so eine logisch befriedigende und überzeugende Kette von Voraussetzungen und Beweisen geschaffen werden könnte.
Unter den Mitteln, mit denen sich Erfahrungen sammeln lassen, sei schließlich noch des Fragebogens gedacht. So leicht er anzuwenden scheint, so bald ist er auch mißbraucht.
Es ist nur Spielerei, alle namhaften Künstler mit der Frage anzufallen, welches sie für die schönste Oper halten. Der Fragebogen enthält Fragen in größerer Anzahl; seine wissenschaftlich brauchbare Bantwortung kann nur von gewissenhaften, sachkundigen, gleichwertigen Personen vorausgesetzt werden. Darum ist Aufstellung und Versendung eines Fragebogens eine schwierige Aufgabe. Man darf nur fragen, was sich ohne eingehende Untersuchung beantworten läßt. Fragen müssen so gefaßt sein, daß sich eine klare und bestimmte Antwort geben läßt. Ferner müssen die Personen, die zur Beantwortung ausersehen werden, nicht wild und zufällig gewählt sein. Nur ihre Gleichwertigkeit ermöglicht eine statistische Auswertung der Antworten. Andererseits dürfen sie nicht allzu gleichartig sein, damit die Antworten kein einseitiges Bild entwerfen. Auch muß die Anzahl der Personen groß sein; sonst lassen sich keine Wahrscheinlichkeitsschlüsse ziehen. Alle Bedingungen werden sich praktisch selten erfüllen lassen, so daß Vorsicht und Mißtrauen hier zur Pflicht werden.
In neuester Zeit hat die phänomenologische Methode wachsenden Einfluß gewonnen, ein Kreis von Forschern hat sich zu ihrer Ausbildung verbunden. Die phänomenologische Methode ist ursprünglich eine Analyse der Bedeutungen, dessen, was in Begriffen gedacht und in Urteilen behauptet wird. Das Ziel der Analyse liegt in der vollständigen Klärung der Bedeutung; d.h. in der adäquaten Erfüllung der Intentionen, in der Zurückführung auf letzte, einfache Tatbestände, die als Anschauungen gelten und mit der Anschauungsgewißheit, mit Evidenz erlebt werden. Solche Phänomenologie ist nicht einfach Beschreibung, deskriptives Verfahren, das sich mit ungeklärten Ergebnissen begnügt. Die Bedeutungsanalyse leistete der Logik und der Psychologie treffliche Dienste, soweit beide mit Bedeutungen zu tun haben.
Neuerdings wurde dann die phänomenologische Methode ausgedehnt auch auf andere Gegenstände. Im Prinzip kann ja jedem Gegenstand gegenüber die Frage aufgeworfen wer-
den, was wir mit ihm meinen. Nicht nur die Bedeutung seiner Bezeichnung, sondern er selbst als Gegenstand der Wahrnehmung, der Erinnerung, der Phantasie kann analysiert werden. Auch hier haben wir es mit dem gedachten und insofern idealen Objekt zu tun. Das Naturobjekt, das Kunstwerk, das Erlebnis des Gefühls oder Willensaktes - all das kann in gleicher Weise geklärt und auf letzte Evidenzen zurückgeführt werden. In diesem Sinne hat Conrad die Phänomenologie des ästhetischen Gegenstandes entwickelt, d.h. des musikalischen, poetischen, bildnerischen Gegenstandes.
Die Mängel der phänomenologischen Methode bestehen in der individuellen Natur ihrer Ergebnisse. Ob jeder andere dieselbe Intention und adäquate Anschauung hat, steht nicht fest. Zweifellos ist die Meinung bei solchen Gegenständen, zumal wenn sie allgemein sind, durch Mitteilung und gleichartige Erfahrung ein stark sozial gefärbtes Produkt. Aber individuelle Differenzen lassen sich nicht prinzipiell ausschließen, wo es sich um eine individualpsychologische Tatsache handelt und Eigenbeobachtung über ihren Gehalt entscheiden soll. Beengt ist die phänomenologische Methode durch die rein deskriptive Natur ihrer Ergebnisse. Indem eine Meinung geklärt wird, ist über deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit, Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit nicht entschieden. Ebensowenig ist die Klärung eine Erklärung; sie bringt keinen Aufschluß über Entstehung und Bedingungen einer Meinung.
Der ästhetische Gegenstand ist nur ein besonderer Gegenstand unter Voraussetzung eines ästhetischen Verhaltens. Jeder Gegenstand kann darum auch ästhetischer Gegenstand werden, keiner braucht es zu sein. Es ist deshalb unerläßlich, auf das ästhetische Verhalten einzugehen, sonst ist man in der Analyse des ästhetischen Gegenstandes führerlos. Das zeigt sich auch bei Conrad. Die genaue Aufzählung aller Einzelheiten einer Melodie, eines Verses, eines Ornaments kann für den ästhetischen Gegenstand ganz irre-
levant sein. Andererseits fragt es sich, ob die einzelnen Phasen des ästhetischen Verhaltens, die Kontemplation, die Einfühlung, die Wertung nicht vielleicht verschiedene Gegenstände haben. So bietet Conrad einerseits zu viel, andererseits zu wenig.
Man kann den ästhetischen Gegenstand auch definieren als den Gegenstand, der eine ästhetische Wirkung ausübt oder auszuüben geeignet ist. Dabei darf man nicht übersehen, daß der Gegenstand nicht allein für die ästhetische Wirkung in Betracht kommt, sondern muß bedenken, daß auch der Zustand dafür wesentlich ist. Die Abgrenzung zwischen beiden kann nur so erfolgen, daß man zum Gegenstande alles rechnet, was vom Erlebenden getrennt, ihm gegenübergestellt werden kann.
Man unterscheidet zwischen selbständigen und unselbständigen Gegenständen. Jene bedürfen für ihr Dasein keines anderen Gegenstandes, diese dagegen bedürfen eines solchen. Jene sind Dinge, Objekte, diese deren Eigenschaften, Vorgänge, Zustände, Beziehungen. Dabei kann es unselbständige Gegenstände erster und zweiter Ordnung geben, insofern auch die Eigenschaften untereinander wieder in Beziehungen stehen. Im ästhetischen Verhalten können nun alle Formen des Gegenstandsbewußtseins beteiligt sein: Wahrnehmung, Erinnerung, Phantasie, Denken. Am wenigsten sichergestellt ist die ästhetische Wirkung der Denkgegenstände als selbständiger Gegenstände. Darin liegt die relative Berechtigung der Behauptung, daß die ästhetischen Gegenstände anschaulich sein müßten. Jedenfalls brauchen wir einem solchen Reichtum gegenüber außer der phänomenologischen Methode alle oben dargetanen Verfahren.
Moritz Geiger legt im Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung dar, daß die Gegenüberstellung „Induktiv“ und „Deduktiv“ keine vollständige Disjunktion sei. Die Induktion ist ihm nur eine Methode, auf Grund von Tatsachen zu Erkenntnissen zu kommen. Der Satz „Orange liegt in der Farbenreihe zwischen Rot und
Gelb“ ist nicht durch Induktion, durch Verallgemeinerung gewonnen; einmaliges Anschauen überzeugt, daß diese Beziehung ein für allemal gilt, daß sie gelten muß, daß es sich hier um Wesensgesetzlichkeit handelt, daß es gar nicht anders sein kann. Durch Einsicht in das allgemeine Wesen solcher Beziehungen an Hand des einzelnen Falles ist hier Erkenntnis möglich. Intuition, nicht Induktion hat dazu geführt. Auch hier kann das Experiment unterstützend eingreifen, aber nicht das induktive, bei dem aus den Aussagen der Versuchspersonen das Resultat gewonnen wird, sondern das intuitive, bei dem das Experiment nur die Aufgabe hat, die Tatbestände herzustellen, an denen die allgemeine Gesetzlichkeit einsichtig wird (ähnlich wie bei der Zeichnung in der Mathematik). Hier interessiert nicht die Fülle zufälliger individueller Erlebnisse sondern die Wesensbestimmtheit der Phänomene.
Unleugbar besteht solche Intuition, wie Geiger sie scharfblickend hervorhebt. Man darf nicht vergessen, daß Induktion und Deduktion Schlußweisen sind, und daß sie die Sicherheit dessen, woraus geschlossen wird, voraussetzen. Die Axiome, die Träger eines deduktiven Lehrgebäudes, können nicht selbst wieder deduziert werden, und eine Gewinnung durch Induktion würde ihnen die Gewißheit rauben, die sie besitzen müssen. Für diese Axiome ist darum sehr früh eine unmittelbare Einsicht, eine Intuition geltend gemacht worden. Aber auch die Voraussetzungen der Induktion sind Wahrheiten, Tatsachenwahrheiten. Die phänomenologische Methode wendet nun die Intuition auf solche Tatsachenwahrheiten an, indem sie den qualitativen Bestand einer Erscheinung genau festzustellen sucht und sich dabei auf ihr Wesen beschränkt. So abstrahiert sie von den individuellen Besonderheiten des zu erfassenden Zustandes und Gegenstandes bei ästhetischem Verhalten und sucht nur deren große bleibende Züge zu bestimmen. Sie unterscheidet etwa einen ästhetischen vom außerästhetischen Genuß, die Lust vom Wert, den Genuß vom Gefallen, und sucht überall die
Merkmale anzugeben, die einen solchen Tatbestand charakterisieren. Wiederholte Versenkung in dasselbe Phänomen, Wechsel in seiner Vergegenwärtigung (Wahrnehmung - Vorstellung - innere Konstruktion), Einstellung auf das Wesen gehören zur regelrechten Anwendung der Methode, die an geschauten Tatsachen ihre natürliche Kontrolle findet. Von der psychologischen Untersuchung unterscheidet sich die phänomenologische nur dort streng, wo jene induktiv verfährt, wie bei Durchschnittsberechnungen, Aufstellung von Tabellen, von quantitativen Gesetzmäßigkeiten. Dagegen ist die psychologische Einzelbeobachtung, die doch die Grundlage zu solchen Induktionen bildet, ihrem Wesen nach nicht von der phänomenologischen Forschung verschieden, nur daß diese sich auf die notwendigen Züge beschränkt und eine viel eindringendere Beobachtung vornimmt. Die phänomenologische Forschung nähert sich dem inneren Experiment, sofern sie die Phänomene, die sie beobachten will, durch phantasiemäßige Konstruktion herstellt, und dem äußeren Experiment, sofern sie es durch Reize erzeugt. Sie findet ihre natürlichen Grenzen an den sogenannten Zufälligkeiten, an den individuellen Unterschieden von Zustand und Gegenstand, an den quantitativen Beziehungen, an nur induktiv erkennbaren Gesetzmäßigkeiten, und an den feinsten Differenzen, die sich der Schauung nicht mit Sicherheit enthüllen. So bildet die phänomenologische Methode eine Ergänzung der empirischen Methoden zur Erforschung des ästhetischen Verhaltens.
Literatur.
Calkins, An attempted Experiment in psychological
Aesthetics.Psychological
Review, 1900, Bd. 7.
Cohn, Experimentelle Untersuchungen über die
Gefühlsbetonung der Farben, Helligkeiten und ihrer
Kombinationen. Wundts Philosophische Studien, 1894/ 1900, Bd. 10 und 15.
Witmer, Zur experimentellen Ästhetik einfacher
räumlicher Formverhältnisse. Philosophische Studien,
1894, Bd. 9.
Major, On the affective ton of simple sense Impression.
American Journal of Psychology, 1895, Bd. 7.
Martin, An experimental study of Fechners principles of
Aesthetics.Psychological
Review, 1906, Bd. 13, S. 142ff.
Koffka, Experimentaluntersuchungen zur Lehre vom Rhythmus.
Leipzig 1908.
Volkmann, Die Grenzen der Künste. Leipzig 1903.
Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. 3. Aufl. Leipzig 1910.
Taine, Philosophie de l’art. 4. Aufl. Paris 1885.
Grosse,
Die Anfänge der Kunst. Freiburg i. B. 1894.
Conrad, Der ästhetische Gegenstand. Zeitschrift
für
Ästhetik, Bd. 3, S.71 ff., vgl. auch ebenda, Bd. 4.
Ein empfängliches Verhalten wird nicht ohne einen ästhetischen Gegenstand wach; diesen können wir aber nicht würdigen, ohne den Zustand zu erforschen, in den der empfängliche Betrachter gerät. Wir zweifeln nicht an dem Kunstwert einer pergamenischen Athena Parthenos; aber wir bereichern die ästhetische Einsicht wenig, wenn wir den Gegenstand als marmornes Bild beschreiben, aussagen, das sei eine Athena, auch nicht, wenn wir den Faltenwurf des Gewandes anschaulich schildern. Es ist für die Ästhetik nicht viel gewonnen, wenn wir mit geschichtlichen Methoden uns die Größe der damaligen Umgebung wiederaufbauen und dartun, was die Erinnerung der Menschheit an Wissen über das Kunstwerk überliefert. In den ruhigen Marmor fühlen wir eine Seele voll hoher Gaben ein; - aber nur, wenn verständnisvolle Betrachtung uns hilft, mit dem beseelten Werk zu fühlen und es unbefangen zu würdigen. Erst dann werden wir uns darüber klar, daß Hoheit und Würde der Göttin und nicht dem Steinblock zugeschrieben werden. Das ästhetische Objekt als Teilursache der ästhetischen Wirkung enthält mehr als das Objekt der Realwissenschaften. Es zählt auch dazu, was an gegenständlicher Bestimmung der Auffassung und dem Verständnis entstammt. Zum Objekt rechne ich die Beschaffenheiten, die als gegenständlich und nicht als zuständlich beurteilt werden. Sofern diese Beschaffenheiten als Bedingungen des ästhetischen Ausdrucks wirken, ist das ästhetische Objekt das naive Objekt.
Vom ästhetischen Gegenstand hat man lange gelehrt, er müsse unter allen Umständen anschaulich sein. Die Be-
hauptung, daß auch Unanschauliches, Gedachtes ästhetisches Objekt sein kann, wird meist bestritten. Die neueren Philosophen hatten das Schöne auf die Anschauung beschränkt, und die Psychologen, die überhaupt Gedanken als besondere Erlebnisse nicht anerkennen, waren natürlich damit einverstanden. So ist es fast zum Dogma der Ästhetik geworden, daß die ästhetischen Gegenstände sämtlich anschaulicher Natur seien. Kant hat sich für diese Meinung eingesetzt und J. Cohn folgt ihm darin. Und doch besteht, wenn auch meist übersehen, das wichtige Problem, ob nicht auch nur gewußte Gegenstände ästhetisch wirken können. Die Frage ist durchaus noch nicht entscheidend beantwortet. Man wird dazu auseinanderhalten müssen, ob es sich um gewußte erinnerte Gegenstände handelt oder um gewußte neue Gegenstände. Daß ein Erinnerungswissen um schöne Dinge eine eigene Wirkung ausüben kann, wird man vielleicht zugeben. Wenn ich etwa ein Bild vom Innern der ravennatischen Galla-Placidiakapelle betrachte, so bieten sich meiner Anschauung Wölbung, Grab, Mosaikgestalten und Fenster. Ein Erinnerungswissen von der Umgebung wird meine Stimmung wesentlich mitbestimmen, auch wenn die Phantasie mir nichts davon vorspiegelt. Auch, was ich vom hohen Alter, von der ehrwürdigen Symbolik des Raumes, von den menschlichen Werten der Schöpferin des Gebäudes weiß, bereichert den ästhetischen Eindruck. Was so die Stimmung des Raumes färbt, ist natürlich nicht die kalte Befriedigung des gelehrten Ehrgeizes. Wo sie vorhanden ist, hat sie so wenig echte ästhetische Wirkung, wie das Wissen davon, daß solche Bauwerke den Geschmack zu befriedigen pflegen. Nur ein ungerufen neu auftretendes Wissen könnte ästhetisches Verhalten auslösen.
Zur Prüfung dieser Frage wird man in erster Linie poetische Werke heranziehen müssen. Th. Meyer hat in seinem „Stilgesetz in der Poesie“ (1901) darauf hingewiesen, daß nicht nur Anschauungen, sondern auch Wissen Grundlage einer ästhetischen Wirkung sein kann. Aber auch in
anderen Künsten kann Unanschauliches eine Rolle spielen. Wir denken uns in Ideen und Stimmungen hinein. Die Sphinx wirkt großartig, bannend, weise, im Besitz des Weltgeheimnisses. Ein Gebäude erscheint uns stolz, trotzig, tot; so etwas kann rein unanschaulich gegeben sein. Ebenso verhält es sich mit der vom empfänglichen Menschen belebten und beseelten Natur, mit ihrer Hoheit, Lieblichkeit und Nachdenksamkeit. Noch kürzlich hat Cohn behauptet, nur Anschauliches sei von ästhetischem Wert. Aber er hat selbst zugegeben, daß Übergänge zum Abstrakten vorkommen. In der Poesie spielen Anschauungen eine weit geringere Rolle, als man gewöhnlich glaubt. Vielmehr sind es da vielfach Gedanken, die den Gegenstand des ästhetischen Verhaltens bilden. Flüchtig, unvollständig, wie eine leise und fragmentarisch erklingende Begleitung ziehen Bilder durch die Seele. Gewiß gibt es da größere, individuelle Unterschiede. Gedanken von ästhetischer Bedeutung (Edel sei der Mensch, hilfreich und gut) kann man mit Volkelt als Bedeutungsvorstellung bezeichnen, aber man muß sich gegenwärtig halten, daß diese dann zumeist nicht anschauliche Vorstellungen sind. Gewiß brauchen die Gedanken vielfach anschauliche Träger, Symbole, Zentren der ästhetischen Kontemplation; aber der eigentliche Gegenstand der Bewertung sind nicht nur diese Symbole, sondern ist vor allem, was sie bedeuten. Die Unmittelbarkeit der ästhetischen Auffassung geht damit nicht verloren, weil auch Gedanken unmittelbar gegeben sein können. Unmittelbarkeit ist nicht mit Anschaulichkeit zu verwechseln. Nicht nur in der Poesie, auch in der Malerei, in der Musik und in anderen Künsten kann Unanschauliches im ästhetischen Gegenstande mitgegeben sein, freilich meist als unselbständiger, anschauliche Bestandteile ergänzender Faktor. Wie sehr im gesamten Kunstgenuß sonst Anschauungen vorherrschen, ist zu bekannt, als daß man es auszuführen brauchte.
Zu ästhetisch wirksamer Verschmelzung mit dem Wahrnehmungsgegenstande sind außer den Vorstellungen auch
Gedanken, Bewußtheiten und Bewußtseinslagen geeignet. Eine Landschaft atmet Wachstum und Gedeihen, weckt den Gedanken an fördernd freie Entfaltung. Hier ist der Zusammenschluß der anschaulichen und der unanschaulichen Elemente ganz innig und störungslos. Was gesehen und vorgestellt ist, bedeutet, was an Gedanken angeregt worden ist. Diese Bedeutung ist von ihrem Symbol getragen, haftet ihm an, wie die Bewegung an der Masse, die Farbe am Tisch, die Klangfarbe am Ton. Das Ausgedrückte ist mitgemeint. Dabei kann in der Ästhetik zunächst davon abgesehen werden, ob die Vergegenständlichung selbst schon eine gedankliche Beziehung einschließt. Bewußtheit nennt Ach das Gegenwärtigsein eines unanschaulich gegebenen Wissens; andere sprechen dann schlichter von Gedanken. Den Ausdruck Bewußtseinslagen hat Marbe eingeführt, um zu bezeichnen, daß man wissen kann, was man meint oder erlebt, ohne im Augenblick schon einzelne Inhalte genau aufzeigen zu können. Gewißheit und Zweifel, die man früher unklar mit den Gefühlen zusammenwarf, solche Bewußtseinslagen sind als ästhetische Objektsrepräsentanten in der Poesie häufig genug. Vielfach bilden wir uns keine anschaulichen Vorstellungen und doch folgen wir dem Dichter leicht. „Mir ist, als wenn ich längst gestorben bin,“ dieser Vers läßt eine Bewußtseinslage anklingen, während der Anfang des Gedichts anschauliche Vorstellungen wachruft: „Ich liege still im hohen grünen Gras.“
Gerade erst durch ihren Verzicht auf einzelne anschauliche Vorstellungen wird die Sprache der Dichtung zu einer wunderbar stoffentrückten Abbreviatur der plumperen Wirklichkeit. Erst so gewinnt sie ihre vereinfachende Kraft. Die Bewußtseinslagen und Bewußtheiten, die dem Sprachverständnis dienen, sie konzentrieren weitschichtiges und verstreutes Material. Auf diese Weise wird es möglich, zeitlich und räumlich weit auseinanderliegende zusammenhänge eng aneinanderzurücken, Verwirrendes wegzulassen, Wirksames auszuwählen, zu stilisieren. Deshalb kann schon gelesene
Poesie einen starken, erschütternden Eindruck hervorrufen, obwohl die anschaulichen Einzelinhalte selbst der Form leiser mitschwingen. Keine Stilregel ist wohl einseitiger gewesen, als die Horazische ut pictura poesis. Man darf nicht vergessen, daß es auch Gedanken gibt, die sich anschaulich gar nicht oder nur ganz andeutend wiedergeben lassen. Wie Unsterblichkeit und Zeit, Fruchtbarkeit oder Jugend anders als derb allegorisch (also mindestens gezwungen) veranschaulicht werden könnten, ist schwer zu sagen. Hier wird es sinnlos, Anschaulichkeit um jeden Preis zu fordern. Nur in der Tatsache, daß Gedanken ganz ohne Symbole nicht als ästhetische Gegenstände vorkommen und daß diese Symbole stets anschaulich gegeben sind, liegt die Wahrheit der Behauptung, alle ästhetischen Gegenstände seien anschaulicher Natur. Man muß ihr nur eine andere Form geben, indem man sagt: Gedanken und Bewußtseinslagen sind fast nie selbständige ästhetische Gegenstände; als unselbständige dagegen spielen sie eine große Rolle. Die Bedeutungen anschaulicher Gegenstände werden mit ihnen zu ausdrucksvoller gegenständlicher Einheit verbunden. Jaspers hat neuerdings zur Erklärung gewisser Tatsachen halluzinatorischer Art von leibhaftigen Bewußtheiten gesprochen. Eine solche liegt vor, wenn ein Kranker sich nicht von dem Gedanken losmachen kann, es sei ein Wesen hinter ihm im Zimmer, ohne daß er sich dies Wesen irgendwie vorstellen kann. Solche leibhaftigen Bewußtheiten sind wohl auch im ästhetischen Verhalten zu beobachten. Man denke nur an Erlebnisse bei der Lesung von Dramen und Romanen, wo die anschauliche Phantasietätigkeit zurücktreten kann, obschon die Ereignisse lebendig miterlebt werden. Eine eindringendere Untersuchung würde hier wohl noch viele Besonderheiten aufdecken und genug an mitbewußten, unanschaulichen ästhetischen Sachverhalten.
Die merkliche Beschaffenheit eines ästhetischen Objekts, die für ein ideales ästhetisches Verhalten wirksam gedacht wird, kann anschaulich und unanschaulich vergegenwärtig
werden. Das selbständige Objekt (der Träger von Eigenschaften, Vorgängen, Zuständen, Beziehungen, Bedeutungen) ist in der Regel anschaulich und gehört in diesem Falle dem optischen oder akustischen Gebiet an. Das ästhetische Objekt ist eine Wirklichkeit des Gegenstandsbewußtseins und damit unabhängig von der Realität oder Irrealität in theoretischer und praktischer Hinsicht. Daraus ergibt sich die prinzipielle Gleichwertigkeit der ästhetischen Wahrnehmungs-, Erinnerungs-, Phantasie und Denkgegenstände. Künstlerische Stoffwahl und Komposition ist nicht auf die Welt der äußeren Erfahrung zu beschränken.
Solche Überlegungen brachten Fechner zu seiner Unterscheidung zwischen dem direkten und dem relativen (assoziativen) Faktor des ästhetischen Gegenstandes. Wir rechnen zum direkten Faktor alles, was unmittelbar gegeben ist, sei es primär anschaulich, sei es sekundär vorstellbar oder auch denkbar. Wenn Leibl die Dorfpolitiker malt, so zählen zum direkten Faktor für den Kunstliebhaber: die fünf Gestalten, das Zimmer, die Fenster, aber auch Gruppierung, Farben, Helligkeitswerte. Zum relativen Faktor gehören:
1. Der assoziative Faktor, die Erinnerung an ähnliche Szenen etwa oder an politische Ereignisse, die dem Bilde eine besondere Färbung geben, an andere Bilder des Malers, an seine Lebensgeschichte vielleicht.
2. Der emotionale Faktor. Hier meinen wir die Stimmung lebhaften Interesses, die alle die Gestalten beseelt, nach der Individualität abgestimmt und etwas gehalten, wie es dem Stand und dem Alter entspricht.
3. Der aktive Faktor. Der Gegenstand erscheint anregend, tief und reich.
4. Der symbolische Faktor. Die Szene bedeutet etwas; sie malt einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, aber sie drückt etwas Allgemeines aus, einen wesentlichen Vorgang, typisch für das Menschenleben.
5. Der teleologische Faktor. Der Gegenstand verwirklicht den sinnreichen Vorsatz des Künstlers, entspricht seiner
Norm. Es sind dies echte Bauern in ihrem besonderen Dunstkreis.
Hier erhebt sich die Frage, wieweit der relative Faktor dem Gegenstande und seiner ästhetischen Wirkung zugerechnet werden muß, welche Grenzen und Kriterien dafür aufzufinden sind. Damit würde sich erst eine Lösung des Problems erwarten lassen, ob nur die sogenannten höheren Sinne (Auge und Ohr) am ästhetischen Genuß beteiligt sind, oder ob auch die niederen Sinne mitwirken. Angesichts stofflicher Malerei drängt sich die Frage geradezu auf; man denke nur an die Tuchstoffe der alten Kölner Meister, an Böcklins kühles und feuchtes Wasser.
Unter den Anschauungen sind die akustischen und optischen stark bevorzugt. Den niederen Sinnen schreibt man in der Regel gar keinen oder nur geringen Wert für das ästhetische Objekt zu. Hegel, v. Hartmann, Liebmann haben sie einfach ausgeschlossen; neuerdings auch Bray. Seine Gründe sind folgende:
Die niederen Sinne sind Kontaktsinne, die höheren Fernsinne. Daher rührt der mehr persönliche egoistische Charakter der Genüsse, die wir den niederen Sinnen verdanken. Das trifft besonders beim Geschmacksinn zu, der nur bei Zerstörung der genossenen Dinge wirksam wird. Ähnlich äußert sich Volkelt (Zeitschrift für Psychologie, Bd. 29, S. 208ff.). Bei Gesicht und Gehör geht das Empfinden ohne Spuren der Stofflichkeit vor sich, bei Getast, Geschmack, Temperatursinn dagegen ist das Empfinden zugleich Stoffgegebenheit. Der Geruch steht in der Mitte, darum kann sich dort jene eigentümlich freie, schwebende, begierdelose Stimmung ästhetischer Art entfalten.
Die Eindrücke der höheren Sinne zeigen eine Analysierbarkeit und eine Gesetzmäßigkeit der Elementarbeziehungen (Rhythmus, goldener Schnitt), die den niederen Sinnen fehlen. Hierzu vergleiche man auch Ch. Lalo (Revue philosophique, 1908, Bd. 33, S. 451).
Die Empfindungen der höheren Sinne befreien sich
fast völlig von den Gegensätzen sinnlicher Lust und Unlust. Ihre gegensätzlichen Gefühlstöne sind von anderer Art. Auch hier stimmt Volkelt bei (a. a. O., S. 210f.): Die Empfindungen der niederen Sinne haben eine viel größere sinnliche Annehmlichkeit und Unannehmlichkeit. Lust und Unlust dieser Art lassen sich von den Gesichts- und Gehörsempfindungen leicht abtrennen, während bei den niederen Sinnen Empfindung und Gefühlston unaufhörlich miteinander verschmelzen.
Nach Wundt und Ribot sind die Erinnerungsbilder der niederen Sinne schwach, und die Assoziation zwischen ihnen fehlt fast ganz. Dadurch sind sie unfähig, in einen Aufbau einzugehen. Nach Volkelt liefern Gesicht und Gehör bestimmte und deutlich einprägbare Wahrnehmungsverknüpfungen als in sich zusammengehörige und bedeutsame Gebilde. Nach Groos vermitteln allein die höheren Sinne geistigen Gehalt.
Die niederen Sinne tun Wohl und Wehe des Leibes kund, sie sind Verteidigungssinne. Auge und Ohr dagegen sind Erkenntnissinne. Eine Mittelstellung nimmt nach Bray der Tastsinn ein; doch zählt auch er zu den niederen Sinnen. Eine Bestätigung seiner Ansicht findet Bray in der Tatsache, daß es keine Kunst für die niederen Sinne gibt. Schon das primitive ästhetische Empfinden der Naturvölker ist auf die höheren Sinne eingeschränkt.
Das alles beweist und zeigt doch nur (was niemand bestreitet), daß die niederen Sinne in weit geringerem Maße als die höheren für das ästhetische Objekt in Betracht kommen. Sie sind, für sich genommen, nicht geeignet, durch ihren qualitativen Bestand dauernd zu fesseln und zu befriedigen. Darum können sie doch gelegentlich eine ästhetische Wirkung ausüben. Wundt hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der ästhetische Genuß der Natur wesentlich eine Beteiligung von Geruch und anderen niederen Sinnen einschließt. „Zu dem Genuß einer Winterlandschaft gehört wirklich die Kälte“ (Phys. Psych., Bd. 3, H. 5, S. 128). Keiner der angeführten Gründe schließt aus, daß sich die Empfindungen
der niederen Sinne mit solchen der höheren Sinne zu einer ästhetischen Gesamtwirkung verbinden. Der Anblick einer Blume gewinnt durch ihren Duft. Dasselbe ist bei Geschmacksund Temperaturempfindungen möglich, vielleicht auch bei Tastempfindungen. Deren Vorstellungsresiduen wirken bei dem Anblick so vieler gemalter Fruchtstücke mit. So erhalten die gesehenen und gehörten Gegenstände durch die Mitwirkung der niederen Sinne eine eigenartige Färbung. Diesen Tatbestand hat L.J. Martin zum Gegenstand einer besonderen experimentellen Untersuchung gemacht (Zeitschr. f. Psychologie, Bd. 53). Sie nennt ihn ästhetische Synästhesie und stellt fest, daß nicht nur akustische Mitempfindungen bei optischen Wahrnehmungen einen ästhetischen Einfluß gewinnen (inneres Hören eines Wasserfalls gegenüber dessen bildlicher Darstellung), sondern auch Pseudoempfindungen der niederen Sinne. Besonders stark waren darunter die kinästhetischen, die Tast-, Temperatur- und Organempfindungen vertreten, während Geschmacks- und Schmerzempfindungen zurücktraten. Sie konnte zugleich wahrscheinlich machen, daß die ästhetische Beurteilung von der Lebhaftigkeit der Pseudoempfindungen abhängig war. Diese steigerten sowohl den mißfälligen wie auch den gefälligen Eindruck von Bildern. Es wäre wünschenswert, eine ähnliche Untersuchung bei Eindrücken niederer Sinne als selbständigen Gegenständen auszuführen. Eine selbständige ästhetische Bedeutung kommt den niederen Sinnen vielleicht nur selten zu, wie schon der Mangel einer eigentlichen Kunst für sie beweist. Einen Beitrag zum ästhetischen Gegenstand liefern sie gewiß; ihre Inhalte werden als unselbständige ästhetische Gegenstände wirksam. Darum kann man sie auch nicht prinzipiell von der Analyse des ästhetischen Verhaltens ausschließen. Allerdings sind ihre außerästhetischen Eigenschaften relativ stark, ihre ästhetischen relativ schwach entwickelt.
Ferner werden sich Elemente, die der Wahrnehmung entstammen, mit solchen aus der Erinnerungs- und Phantasietätigkeit zu einem ästhetischen Gegenstande verbinden. Die
sonnenbeglänzte Wiese mit ihren Frühlingsblumen, der frischgrüne Wald, die rauchende Hütte und der würzige Duft, all das weckt auch mannigfache Vorstellungen. Davon ist aber nicht jede geeignet, den Empfindungsgegenstand zu umspielen und mit ihm zu verschmelzen, ohne von ihm abzuführen. Wenn ich mir etwa das Haus vorstelle, das ich mir in solcher Gegend erbauen möchte, so wird damit die Aufmerksamkeit von dem ursprünglichen Gegenstande abgelenkt; seine Einheit droht verloren zu gehen. Nicht um diesen Preis dürfen Vorstellungen der Erinnerung oder der Phantasie zu dem Wahrnehmungsgegenstande. hinzutreten. Doch bleibt eine reiche Fülle von Vorstellungen, die den ästhetischen Gegenstand zu seiner duftigen und gelösten Eigenart ausgestaltet.
Vorstellungen sind stets wichtige Bausteine des ästhetischen Gegenstandes. Der Künstler bedarf ihrer beim produktiven ästhetischen Verhalten; seine Phantasiebilder repräsentieren ihm das Werk vor dessen Vollendung. Viele Kunstfreunde können ein Musikwerk oder ein Gemälde auch in der Erinnerung genießen. Wahrnehmung ist also nur eine ausgezeichnete, vielleicht die häufigste und ästhetisch wirksamste anschauliche Repräsentation ästhetischer Objekte. Der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Vorstellung ist im ästhetischen Verhalten nicht so einschneidend wie in wissenschaftlicher Beobachtung. Die individuellen Anlagen aber bedeuten hier viel; denn von ihnen hängen tiefeingreifende Änderungen im qualitativen Bestande der Vorstellungen ab. Es gibt Musiker, die eine Partitur genießen, wie andere ein gelesenes Gedicht. Aber das wirkliche Anhören der Aufführung vertieft den Eindruck und rundet ihn. Schon darum drängt es den Komponisten, sein Werk zu dirigieren.
Jedenfalls ist das ästhetische Objekt nicht als Reiz hinreichend zu beschreiben, ebensowenig nur als Empfindung, oder nur als reales Objekt, wiederum auch nicht als realer psychischer Vorgang und keinesfalls als ideale Konstruktion allein. Vielmehr ist das ästhetische Objekt ein Gegenstand
für Wahrnehmung, Erinnerung, Fühlen und Wissen. Um es gebührend aus der platten Wirklichkeit herauszuheben, hat man daher zu der Auskunft gegriffen, die ästhetische Welt als Schein, Illusion und Selbsttäuschung zu bezeichnen. Zu solcher Auffassung neigen Lange und Groos. E. v. Hartmann begründet die Lehre vom ästhetischen Schein erkenntnistheoretisch, indem er zeigt, wie nicht die gedachten Dinge an sich, sondern nur die subjektiven Erscheinungen ästhetisch wirken. Die naiv-realistische Übertragung des Prädikats „Schön“ auf die Dinge an sich, ist ihm nur statthaft, sofern man sich der Uneigentlichkeit dieser Ausdrucksweise bewußt bleibt. Nur dort, wo eine Ablösung des Scheins von der Realität gelingt, wie bei den Eindrücken der höheren Sinne, kommt es zum ästhetischen Verhalten. Bei dramatischen Aufführungen abstrahieren wir vom wirklichen Schauspieler, bei musikalischen Darbietungen von den Spielern. Beim naiven Realismus und beim subjektiven Idealismus wäre solche Ablösung des Scheins und damit ein ästhetisches Verhalten unmöglich. Nur der transzendentale Realismus, der subjektive Erscheinung und die Realität unterscheidet, macht das ästhetische Verhalten verständlich. Der ästhetische Schein ist nach Hartmann keine Illusion, sondern ideale Realität als wirklich vorhandener Bewußtseinsinhalt. Er ist aufrichtig und rein, will niemand täuschen und beansprucht nicht, objektive Realität zu sein. Der Sitz des Schönen ist nicht in einer übersinnlichen Idee zu suchen, deren bloßer Abglanz die Erscheinung wäre; vielmehr gehört der übersinnliche ideale Gehalt unmittelbar zur Erscheinung und wird in ihr gefunden. Der Schein ist auch von der subjektiven Realität des Beschauers und seiner Seelentätigkeit losgelöst. Sobald die Reflexion eintritt, ist es mit dem reinen ästhetischen Verhalten vorüber. Im Selbstvergessen liegt noch keine Illusion. Sie beginnt nach Hartmann erst beim Hineinversetzen des Ich in den Schein und kann nur aus den ästhetischen Scheingefühlen und der realen ästhetischen Lust erklärt werden.
Für diese Scheingefühle wird das Gesetz aufgestellt:
überall, wo eine Realität geeignet ist, reale Gefühlswirkungen in einem mit ihr in reale Beziehungen tretenden Subjekt aus zulösen, ist auch der von dieser Realität abgelöste oder ihr künstlerisch entsprechende Schein geeignet, die nämlichen Gefühle als ideale ästhetische Scheingefühle in dem ihn ästhetisch auffassenden Subjekt auszulösen. Man kann nach Hartmann reaktive und sympathische Scheingefühle unterscheiden. Die realen Gefühle besitzen ein viel größeres Beharrungsvermögen als die Scheingefühle, weil sie viel intensiver sind. Dagegen sind die Scheingefühle ungleich wandelbarer und modulationsfähiger. Werden diese in den Schein projiziert, so wird der Schein bedeutend und beseelt.
Wenn wir diese Ausführungen Hartmanns überblicken, so drängen sich uns folgende Gegenbemerkungen auf: Die Anwendung erkenntnistheoretischer Kategorien auf das ästhetische Gebiet ist bedenklich, ebenso wie das auch bei logischen Kategorien bedenklich ist. Jedes selbständige Gebiet menschlichen Geisteslebens ist zunächst nach eigenen Kategorien zu beurteilen. Insonderheit läßt sich der ästhetische Gegenstand nicht einfach unter erkenntnistheoretische Kategorien subsumieren. Er kann ein realer sein, wie ihn die Natur, die Skulptur oder das Kunstgewerbe bieten, er kann ein Darstellungsobjekt sein, wie in der Poesie oder in der Schauspielkunst, er kann aber auch ein unmittelbar erlebter Gegenstand sein, wie eine ferne Melodie. Wie will man unter solchen Umständen ausschließlich von ihm, als von einer subjektiven Erscheinung reden! Die angeführten Tatsachen erklären sich ungezwungen aus anderen Gründen. Daß man der Natur gegenüber verhältnismäßig spät und selten ein ästhetisches Verhalten annimmt, hängt damit zusammen, daß sie in erster Linie ein anderes, das praktische und daneben das wissenschaftliche, anregt. Daß die Dinge an sich nicht ästhetisch wirken, sondern nur die Erscheinungen für unsere Wahrnehmung, darf nicht in jedem Betracht behauptet werden. Bei der ästhetischen Betrachtung realer Objekte wirken doch auch deren reale Beschaffenheiten mit ein. Nicht auf
den Ausschluß der Dinge an sich kommt es an, sondern auf die Art ihrer Vergegenwärtigung. Wie es mit der gedanklichen, unanschaulichen Vergegenwärtigung steht, ist noch nicht entschieden. Ihre Beschaffenheit freilich muß uns irgendwie repräsentiert sein. Das gilt selbst für die Erscheinungen. Eine Verzeichnung, die nicht als solche wirkt, stört uns ästhetisch nicht, obwohl sie nachweisbar gesehen wird. Daraus muß man schließen, daß die objektiv realen Beschaffenheiten, sofern sie vergegenwärtigt werden, auch ästhetisch wirken können.
Auch die „Scheingefühle“ sind keine glückliche Neuerung. Gemeint sind durchaus reale Gefühle, die wegen des Ausscheidens der praktischen Gesichtspunkte von anderer Wirkung sind als außerästhetische Stimmungen. Alles, was Hartmann über ihre größere Wandlungsfähigkeit und Projektion sagt, läßt sich aus dem ästhetischen Verhalten erklären, ohne daß man einen „Schein“ dafür in Anspruch nehmen müßte. Wir kommen so zu dem Ergebnis, daß der ästhetische Gegenstand erkenntnistheoretisch nicht eindeutig bestimmbar ist. Alle Gegenstände vielmehr, so werden wir sagen müssen, die eine ästhetische Wirkung ausüben können, erregen ein empfängliches Verhalten durch ihre merkliche Beschaffenheit. Ihre Daseinsweise dagegen hat keine unmittelbare Bedeutung, sei sie nun reale Existenz oder ideales Dasein, bloße Bewußtseinsgegebenheit oder ein darüberhinausgehendes Bestehen. Nur wenn sich mit der Daseinsweise die Beschaffenheit des Gegenstandes ändert, kommt auch sie für die ästhetische Wirkung mittelbar in Betracht. Scheinbar steht dem entgegen, daß wir geneigt sind, die Beziehung zur Wirklichkeit besonders zu schätzen. Wir sagen: wie aus dem Leben gegriffen! wie wahr! der Natur abgelauscht! Aber hier handelt es sich nicht um die Existenzweise. Wir wollen die Marmorstatue nicht in Fleisch und Bein umwandeln. Auch wirkliche Dinge bezeichnen wir als unnatürlich und unmöglich.
Wenn man den ästhetischen Gegenstand aus dem direk-
ten und relativen Faktor zusammensetzt, so gelangt man anfangs leicht zu der Meinung Fechners, daß alles was den relativen Faktor ausmacht, durch Assoziation herbeiströme. Man nannte ihn deshalb geradezu den assoziativen Faktor in einem weiteren Sinne. Es fragt sich aber, ob damit alle Bestandteile des ästhetischen Gegenstandes bezeichnet sind. Neben der Assoziation gilt noch die Einfühlung als ein Prozeß, der den Gegenständen Beschaffenheiten zuführt. Ob Einfühlung ganz oder teilweise auf Assoziation beruht, ist in der heutigen Ästhetik noch nicht entschieden. Es fragt sich weiter, welche ästhetische Bedeutung der Unterschied zwischen dem direkten und dem „assoziativen“ Faktor hat, d.h. ob dieser Unterschied für die Ästhetik relevant ist. Darauf kann durchaus nicht allgemein bejahend geantwortet werden; man müßte zuvor den Einfluß eines jeden einzelnen Bestandteiles für sich untersuchen. Ferner fragt sich, ob jede Assoziation für den ästhetischen Gegenstand in Frage kommt. Darauf suchen ich1) und Allesch zu antworten. Endlich wäre zu sagen, ob es ein ästhetisches Assoziationsprinzip gibt. Darauf habe ich in meiner Rezension über Groos zu antworten versucht2).
Um die möglichen Assoziationen zu sichten, fordert v. Allesch die adäquate Anschauung3). Adäquat ist sie, wenn sie sowohl der Intention des Künstlers Rechnung trägt, soweit sie im Kunstwerk erfüllt wird, als auch der eigenen Intention des Kunstfreundes, die sich ihm bei der Betrachtung aufdrängt. Was nicht mehr unmittelbar mit den Erscheinungen im Zusammenhang steht, wie persönliche Erinnerungen, über die Deutung hinausgehendes kunstgeschichtliches oder technisches Wissen, sind daher auszuscheiden. Nur soweit eine Auffassung oder Ergänzung das Gefallen beeinflussen kann, gehört sie zur ästhetischen An-
1) Vierteljahrschrift
für wiss. Philos., 1899, Bd. 23.
2) Götting.
gelehrte Anzeigen, 164. Jahrgang, Nr. 11.
3)
Z. f. Ps., Bd. 54, S. 517.
schauung. Wenig fruchtbar für eine unbefangene Ästhetik sind die modernen Theorien des Symbolismus, Impressionismus und Futurismus oder wie die Schlagworte sonst alle heißen mögen. Als Ausdruck für eine Technik unter anderen, als Versuch eine eigene Kunstsprache auszubilden, als Zeichen für wechselnde Zeitbedürfnisse und künstlerische Tendenzen mag jedes von ihnen bedeutungsvoll sein. Aber eine Theorie der Kunstübung, die über solche Besonderheiten hinwegsehen muß, ist damit nicht bezeichnet. Vielmehr gibt es nichts in der Welt, was nicht ästhetischer Gegenstand sein könnte.
Es schien uns von besonderer Wichtigkeit, auf die Einseitigkeit so mancher Theorien über den ästhetischen Gegenstand hinzuweisen und alle Begriffe aus der Ästhetik zu verbannen, die aus fremden Wissensgebieten unbesehen eingeführt werden, wie besonders solche vom Schein und Scheingefühl. Ebenso haben wir durchgängige Beziehung auf Wirkliches als eine ästhetisch nicht zu begründende Forderung erkannt. Vielmehr mußten wir dem Naturalismus die Anerkennung als grundlegendes Prinzip der Ästhetik versagen. Er hat seinerzeit für technische Verfeinerung viel bedeutet; auch den Schattenseiten des wirklichen Daseins hat er die Teilnahme ästhetischer Kontemplation zugewendet und hat so unseren Gesichtskreis erweitert und bereichert. Aber deshalb darf er die ästhetischen Gegenstände nicht auf die anschauliche Wirklichkeit und deren temperamentvolle Auffassung beschränken. Phantasmen und Gedanken stehen gleichwertig neben Wahrnehmung und Erinnerung, der goldene Berg neben der landschaftlichen Impression.
Es gibt vieles, was nicht Objekt ethischer Beurteilung sein kann, nämlich alles Außermenschliche. Ebenso gibt es vieles, was nicht Gegenstand logischer Beurteilung werden kann, nämlich alles Unbegriffliche. Aber kein Gegenstand ist als solcher unfähig, einen ästhetischen Eindruck zu machen oder dazu beizutragen, keiner ist unfähig, ästhetisch gewertet zu werden. In dieser Universalität der ästhetischen
Gegenstände liegt es begründet, daß der Künstler unter allen Schaffenden die freieste Produktivität aufweist.
Soviel über die Theorien vom ästhetischen Gegenstand.
Literatur.
Th.
Meyer, Das Stilgesetz in der Poesie. Leipzig 1901.
Volkelt,
Der ästhetische Wert der niederen Sinne. Zeitschrift
für Psychologie, 1902, Bd. 29, S. 204ff.
Lalo,
lntroduction á l’esthétique.
Paris 1913.
Bray,
Du beau. Paris 1902.
Martin,
Über ästhetische Synästhesie. Zeitschrift
für Psychologie, 1909, Bd. 53.
Lange,
Die bewußte Selbsttäuschung als Kern des
künstlerischen Genusses. 1895.
Groos, Das
ästhetische Miterleben. Zeitschrift für
Ästhetik, Bd. 4, s.161 ff.
Külpe,
Ein Beitrag zur experimentellen Ästhetik.
American Journal of Psychology, Bd. 14.
– Über den assoziativen Faktor des
ästhetischen
Eindrucks. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Philosophie, 1899, Bd. 23.
v. Allesch, Über das Verhältnis der Ästhetik
zur Psychologie. Zeitschrift für Psychologie, 1910, Bd. 54.
Wenn auch (wie wir sahen) alle Formen des Gegenstandsbewußtseins am Aufbau des ästhetischen Objekts mitwirken können, und wenn dieses hierdurch einen eigentümlichen inneren Reichtum, eine wirksame Fülle gewinnt, so darf man die gesteigerte Teilnahme, die wir ihm schenken, doch am allerwenigsten mit einem Interesse an seiner Realität im Sinne der Naturwissenschaft verwechseln. Von wissenschaftlicher Beobachtung ist der ästhetische Zustand denkbar weit entfernt. Ob etwas dem ästhetischen Objekt Vergleichbares im natürlichen Dasein wiederzufinden, ist für die ästhetische Wirkung höchst gleichgültig. Zwar wird bei historischen Dramen der künstlerische Takt allzu grobe Abweichungen von allgemein bekannten Ereignissen vermeiden; aber doch nur, weil solche Abweichungen indirekt stören, indem sie das Interesse des Zuschauers spalten und dadurch die ästhetische Stimmung beeinträchtigen und so die Einheit des ästhetischen Gegenstandes gefährden. Mythische Ereignisse können sich in mannigfacher historischer Gewandung abspielen, ohne den Kunstwert zu mindern. Ästhetisch motivierte Abweichungen stören weit weniger, als historische Treue in formbrechenden Szenen. Darum ist die Definition der Kunst als einer Nachahmung der Natur völlig schief; stellt sie doch zwischen beiden eine Beziehung her, die für die Wirkung des schönen Werkes ganz irrelevant ist. Tiefste ästhetische Konzentration hebt im Gegenteil den Objektcharakter des Kunstwerkes auf. Freilich legt die Ästhetik nicht gerade diesen Zustand versunkener Betrachtung als Norm des empfänglichen Verhaltens zugrunde. Die Inten-
sität des ästhetischen Verhaltens braucht nicht bis zum Verschwinden aller Gegenstandsbeziehung zu gehen. Früher schon ist nicht diese, sondern das Bewußtsein eigenen Verhaltens, eigener Spontaneität erloschen. Aber auch, wenn sich Gegenstand und Zustand unterscheiden lassen, ist das reine, vollständige und intensive ästhetische Verhalten bei weitem noch nicht gebrochen. Wer aber ein Kunstwerk immer gleich daraufhin untersucht, ob und inwiefern es reale Verhältnisse richtig und unrichtig schildert, tut der Ästhetik keinen Dienst. Er neigt zu erkenntnistheoretischen Erörterungen über den ästhetischen Schein (wie K. Lange), weil ihm die Fähigkeit reiner Kontemplation durch Reflexion erdrückt worden ist. Was wir bisher vom ästhetischen Gegenstande gesagt hatten, gilt nur von einer Seite seines Inhalts und Reichtums, charakterisiert nur die Beschaffenheit, die ihm als aufgefaßtem, wahrgenommenen, apperzipierten Gegenstand zukommt. Er ist dadurch noch nicht schön und häßlich, nicht anmutig und erhaben, aber auch noch nicht beseelt und vermenschlicht, noch nicht Träger eingefühlter Bestimmungen. Es war bisher nur vom Gegenstande vor dem spezifisch ästhetischen Zustande die Rede, vor dem Zusammentreffen damit. Schönheit, Anmut, Beseelung zeigt sich erst nach diesem Zusammenwirken. Sie entspringt einer Wechselwirkung zwischen Objekt und Zustand. Dann erst macht der bereicherte Gegenstand ästhetischen Eindruck. Er ist nicht nur an uns herangetreten, sondern er hat dann auf uns gewirkt und in uns lebhafte, tiefergreifende Reaktionen ausgelöst. Er ist uns wert geworden und zu einem gehaltvollen Wesen. Über die Formen solchen Eindrucks wird später zu handeln sein; doch haben wir im allgemeinen bei der Untersuchung des ästhetischen Zustandes Gelegenheit, auf die Prädikate hinzuweisen, die ihm entstammen.
Wenden wir uns zu den Theorien des ästhetischen Zustandes, so werden wir vor allem auf verschiedene Behandlungen des Einfühlungsproblems stoßen. Jedes Kunstwerk, jeder ästhetisch wirkende Naturgegenstand wendet uns nur
seine Außenseite, seine sinnliche Qualität zu. Wir begnügen uns aber nicht mit deren Auffassung, sondern wir verlebendigen das tote Objekt, wir beseelen die ungeistige Form. Wir legen Gefühle hinein; wir vollziehen die Einfühlung. Um diesen Begriff sind eine Fülle von Theorien entstanden, die teils alles ästhetische Genießen auf Einfühlung gründen, teils nur gewisse Faktoren seiner Entstehung damit bezeichnen wollen. Ehe wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, tun wir gut, noch die ästhetische Einstellung und die Kontemplation zu untersuchen.
Der ästhetische Zustand ist nur einer unter vielen anderen; da er nicht zu den praktischen Notwendigkeiten gehört, ist er stets in Gefahr, von diesen erdrückt oder gehemmt zu werden. Darum bedarf es besonders günstiger Umstände, um ihn aufkommen und sich entfalten zu lassen. Die Aufgabe eines idealen ästhetischen Verhaltens ist nicht etwa leicht zu erfüllen. Zu diesen günstigen Umständen zählen wir in erster Linie eine Richtung auf ästhetisches Verhalten, eine subjektive Prädisposition dafür. Wir bezeichnen sie mit dem Namen „ästhetische Einstellung“. Das Wort Einstellung wird auch sonst viel in der Psychologie gebraucht. Man redet von einer sensorischen und motorischen Einstellung (auf Sinneseindrücke oder auf Bewegungen), wenn man disponiert ist, sie in einer eingeübten Form zu wiederholen; aber man spricht auch von einer Einstellung der Aufmerksamkeit und nennt Einstellung jede Art von Vorbereitung auf eine Leistung. So kann man auf Arbeit und Genuß, auf Briefschreiben und Spaziergang eingestellt sein. In diesem weiteren Sinne wollen wir auch von ästhetischer Einstellung als einer Bereitschaft zum ästhetischen Verhalten sprechen. Darin kann in nuce der ästhetische Zustand selbst gefunden werden. Im Bereitsein ist alles implicite angelegt und virtuell gegeben, was zum ästhetischen Verhalten gehört. Dies Bereitsein ist die erste Stufe des ästhetischen Zustandes.
Die von uns schon dargetane Universalität der ästhetischen Gegenstände ist nicht zum mindesten in der Weite der ästhetischen Einstellung gegründet, die niemals ausschließlich auf Wirklichkeit oder Unwirklichkeit, Menschlichkeit oder Begreiflichkeit allein gerichtet ist, sondern an jedweder merklichen Beschaffenheit aller erdenklichen Objekte Gefallen um ihrer selbst willen finden kann. Die Weitherzigkeit ist Voraussetzung des ästhetischen Verhaltens. Daher fragt denn auch der Kunstliebhaber nicht so sehr nach dem Was als vielmehr nach dem Wie der künstlerischen Behandlung eines Stoffes. Von hier aus gewinnen wir ein neues Verständnis für die Frage nach der Bedeutung der Gedanken für die ästhetische Wirkung. Die Gedanken sind abstrakt und sofern von ärmerer Beschaffenheit als die anschaulichen Inhalte. Sie sind schematischer und begnügen sich vielfach mit vielen Gegenständen gemeinsamen Zügen; damit lassen sie individuelle Merkmale außer Betracht. Wegen dieser Armut treten sie als selbständige Objekte für das ästhetische Verhalten zurück.
Die Wirkung der Einstellung ist eine Einengung des Bewußtseins und der Aufmerksamkeit auf die dem ästhetischen Verhalten entsprechenden Gegenstände. Was mit diesem Verhalten und seinen Gesichtspunkten nichts zu tun hat, wird ferngehalten und bleibt deshalb unwirksam. So scheiden im ästhetischen Genuß beim historischen Drama die Fragen nach seiner äußeren Richtigkeit aus, bei der Büste das Interesse für den Rumpf, bei dem Gemälde die Neugier nach der Herkunft seiner Leinwand. Beim Anhören absoluter Musik fragt kein ästhetisch eingestellter Kunstfreund nach den Vorstellungen, die dem Künstler etwa bei der Komposition vorgeschwebt haben mögen. Alle solche Fragen können im Sinne anderer Verhaltungsweisen aufgeworfen werden, in der reinen ästhetischen Einstellung sind sie nicht angelegt.
Positiv besteht die Wirkung der Einstellung in einem Entgegenschicken aller Prozesse, die ein Objekt im Sinne
des ästhetischen Verhaltens ausgestalten: aufmerksame Wahrnehmung und ergänzungsbereite Vorstellung, affektive und motorische Faktoren, zusammenfassende Funktionen, die einen Gesamteindruck bilden. Es versteht sich, daß verschiedene Objekte nicht alle diese Prozesse in gleichem Maße entfesseln. Darum kann die ästhetische Einstellung nicht immer die gleiche sein, sie muß vielmehr eine wechselnde Gestalt annehmen, die durch Erfahrung, subjektive Anlage und die Objekte erst im einzelnen determiniert wird. Als ersten Unterschied der Einstellungsart bezeichnen wir die willkürliche und die unwillkürliche Einstellung. Bisher hat man angenommen, daß die ästhetische Einstellung nur dann eintritt, wenn eine vorherige Absicht, sich ästhetisch zu verhalten, besteht oder geweckt wird. Wer ein Konzert, eine Theateraufführung, ein Museum besucht, wer in eine schöne Gegend reist, wird sich ästhetisch einstellen. Aber es gibt auch eine latente Einstellung, eine Bereitschaft zu ästhetischem Verhalten, die keiner besonderen Absicht ihre Entstehung verdankt. Sie ist entweder immer vorhanden oder wird durch geeignete Reize ungesäumt herbeigeführt. Es liegt dann an einer besonderen Begabung, wenn sich ein Mensch so leicht ästhetisch einstellt. Ferner kann man zwischen einer allgemeinen und einer speziellen Bereitschaft unterscheiden. In allgemeiner Einstellung befindet sich der Ästhet, der alle Gegenstände nach den Gesichtspunkten aufzufassen liebt, die wir für das ästhetische Verhalten charakteristisch fanden. Meist wird eine spezielle Bereitschaft vorliegen, die übrigens viele Abstufungen hat je nach dem gesuchten Genuß. Hier ist noch ein reiches Feld für genauere Feststellungen offen. Die Einstellung kann sich auch dadurch spezialisieren, daß eine Bereitschaft für bestimmte Phasen des ästhetischen Zustandes entsteht. In diesem Sinne kann man von einer einfühlenden, kritischen, emotionalen, teilnehmenden Einstellung reden. Diese Unterscheidungen führen bereits in eine Individualpsychologie des ästhetischen Verhaltens hinein. Sie hat erst in neuerer Zeit begonnen,
das Interesse des psychologischen Ästhetikers zu wecken. Untersuchungen an Farben und Tönen haben eine überraschende Mannigfaltigkeit der Verhaltungsweisen feststellen lassen.
Es ist klar, daß die Einstellung von großem Einfluß auf das ästhetische Verhalten und seine Wirkung ist. Die wohlgelungene Einstellung wird die Wirkung steigern, das Eintreten eines idealen ästhetischen Verhaltens begünstigen. Die falsche Einstellung wird hindern, aufheben, verzögern. Die spezielle Einstellung ist dabei besonders wirksam. Programmatische Mitteilungen über Werk und Künstler fördern große und rasche ästhetische Wirkungen. Vorbereitung am Klavier vertieft den Genuß eines symphonischen Abends, auf den sie einstellt. Wovon ist der Eintritt einer solchen Einstellung abhängig? Die Willensabsicht genügt nicht, wenn man nicht zugleich weiß, was man erstreben soll; Zielbewußtheit ist eine wesentliche Bedingung. Das setzt wiederum Erfahrung voraus, vergangene Erlebnisse ästhetischen Verhaltens, die sich eingeprägt haben, Bekanntschaft mit ästhetischen Objekten und ihrer Wirkung. Die Erfahrung befestigt sich durch eindringliche Wiederholung. Eine geeignete Unterweisung kann dabei hilfreiche Dienste leisten, indem sie das wildwachsende Interesse beschneidet, das Verhalten diszipliniert, während sie auf die wesentlichen Gesichtspunkte hinweist, die das ästhetische Verhalten bestimmen. Wie entscheidend die persönliche Veranlagung ist, braucht hier kaum besonders gesagt zu werden. Wir setzen ja immer voraus, daß die Anlage und äußere Möglichkeit zu ästhetischem Verhalten besteht. Daher denken wir uns den Genuß als ungestört von Mitmenschen und ungünstiger Umgebung, wir nehmen für optische Eindrücke günstige Beleuchtung, für akustische sonstige Stille an.
Über Dauer und Kraft der ästhetischen Einstellung und ihre zusammensetzenden Faktoren sind wir bisher ungenügend unterrichtet. Sie unterliegt wie alle Einstellungen der Ermüdung und Abstumpfung. Beim idealen ästhetischen
Verhalten kann man davon ebenso absehen, wie von der Festigkeit gegen Störung und Ablenkung. Über die einzelnen Faktoren der Einstellung kann uns erst zukünftige Forschung Auskunft geben. Es erheben sich die Fragen nach der Tiefe der Konzentration, nach der Stärke der Determination, nach der Erwartungsspannung, nach der Intention und Präperzeption. Außer dem volitionalen müßte man noch einen emotionalen und intellektuellen Faktor hervorheben. Die Vorstimmung besonders ist schwer zu beschreiben und zu analysieren. Auch innerhalb der ästhetischen Einstellung kann dieser emotionale Faktor verschieden gerichtet sein; er kann sich auf Tragisches, auf Komisches, auf Anmutiges oder Erhabenes wenden. Die Erwartungsspannung vor der Lektüre eines Romans, die eigentümliche Behaglichkeit in der Bereitschaft zum ästhetischen Genuß, die innerliche Freiheit von Lebenssorgen, praktischen Aufgaben, wissenschaftlichen Problemen, der gute Wille zur Hingabe an das Objekt gehören allgemein dazu. Dem intellektuellen Faktor verwandt ist ein gewisses Verhalten der Aufmerksamkeit, eine geistige Bereitschaft zur Aufnahme ästhetischer Eindrücke, Bewußtheit stofflicher Kenntnisse, technischer Überlegungen. Die mannigfaltige Wirksamkeit dieser Faktoren ist vorläufig kaum zu übersehen. Man hat dies Eingangstor bisher meist wie einen selbstverständlichen Rahmen betrachtet, in dem sich das ästhetische Verhalten abspielt.
Im ästhetischen Zustande ist die Kontemplation (ein Bemerken und Erfassen des Gegenstandes unter dem Gesichtspunkte des ästhetischen Verhaltens) das erste nach der Einstellung erreichte Stadium, das dann alle weiteren trägt. Deutliche Gesamtauffassung und deutliche Einsicht in die Qualität und Bedeutung der Teile ist das Ziel solcher Kontemplation, die nicht nur die Wahrnehmung des äußeren Gegenstandes, sondern auch das Verständnis seines Ausdrucks umfaßt. Die Kontemplation ist eine Bedingung der
ästhetischen Wirkung; aber die Befriedigung, die das Interesse am Gegenstande gewährt, darf nicht mit dem Gefallen an ihm verwechselt werden. Unter günstigen Umständen kann sich die Kontemplation zu völliger Hingabe und Versenkung in den Gegenstand steigern, die Ort und Zeit, das Ich und seine sonstigen Aufgaben völlig vergessen läßt. „Man ist ganz weg“ oder „ganz Auge“. Man erwacht wie aus einem schönen Traume, wenn Störung oder Abstumpfung die Kontemplation aufheben. Dies Auffassen und Beachten ist nicht, wie bei der wissenschaftlichen Beobachtung auf das Ansich des Gegenstandes gerichtet, sondern nur auf das deutliche Erleben seiner Beschaffenheit. Die Erfassung der Empfindungsinhalte (Töne und Farben), sowie der Vorstellungselemente gehört ebenso zur Kontemplation, wie die Erfassung von Formen und Gestalten (Melodie, Rhythmus, Raumform). Die Kontemplation unterwirft diese Elemente einer Synthese, deren Aufbau die Elemente nicht aufhebt; sie werden so zueinander geordnet, daß ein neues Ganzes sich bildet, mehr als die Summe der Elemente. Analytische Naturen zerlegen den Gesamteindruck wieder zur vollständigeren Erfassung des Gegenstandes. Von kontemplativem Verständnis reden wir angesichts von Eigenschaften, die gegenständlich gefaßt als Ausdruck der Objektsbeschaffenheit zu bezeichnen wären. Für jeden, der sich ästhetisch verhält, kann der Ausdruck genau ebenso im Objekt liegen, zu ihm gehören, wie Farben und Töne auch. Die Menschen im Roman hassen und lieben, sie sind auf Bildern andächtig, die Madonna schaut gütig und hoheitsvoll. Man könnte statt von Kontemplation auch von Apperzeption sprechen; nur müßte man dann ästhetische Apperzeption sagen, weil sonst der Ausdruck nicht zur Apperzeption gehört. Der gemalte Apfel enthält nach gewöhnlicher Apperzeption nicht alle die Eigenschaften, die ihm nach der ästhetischen eignen: reif, saftig, gesund zu sein. Je fremder ein Objekt der Betrachtung ist, um so mehr bedarf es der Aneignung von Einzelheiten. Die Dauer der ausbauenden Kontemplation ist außer-
dem von der Fülle der Einzelheiten, der Verwickeltheit einer Komposition, der Eindeutigkeit des Ausdrucks mit abhängig. Auch hier müßte weitere Untersuchung anknüpfen. Mit alledem ist nicht gesagt, daß die Kontemplation überhaupt aufhört, wenn Erfassen und Verständnis vollendet sind. Man verharrt über die Anfangsstadien hinaus in der Kontemplation. Die einzelnen Stadien des ästhetischen Verhaltens sind Fäden zu vergleichen, die zu verschiedenen Zeiten in das Gewebe eintreten, die alsdann darin bleiben und einander mannigfach durchschlingen. Die Kontemplation schreitet vom Unbestimmten zum Bestimmten fort, nicht ohne daß dabei Illusionen eine Rolle spielen, Farben gesehen werden, wo keine sind. (Martin, Ritook. Zeitschr. f. Ästh., Bd. 5, S. 365, Pseudochromästhesie.)
Die Kontemplation erhebt sich in natürlichem Stufengang vom Wahrnehmungsgegenstande zu seinem Ausdruck. Aber es gibt nicht nur zwei solcher Stufen, es können sich deren mehrere superponieren. Wenn ich Noten lese, muß ich sie erst in Töne umdeuten, ehe ich deren Ausdruck verstehe. Darum genügt es nicht, einen primären und einen sekundären Gegenstand zu unterscheiden. Auch die Gegensätze zwischen Erscheinung und Idee, Gestalt und Ausdruck, direktem und assoziativem Faktor erschöpfen die vorkommende Mannigfaltigkeit nicht. An verschiedenen Prädikationen erkennt man leicht, welche Gegenstandsdurchbildung jeweils gemeint ist. Wenn man Rethels Bild „Gerechtigkeit“ mittels einer Kamera auf einem Schirm aufleuchten läßt und spricht dann von ungünstiger Stellung des Gegenstandes, so gilt das vom Projektionsbild. Gute Komposition lobt man an dem Bilde des Meisters, eherne Züge werden der Frauengestalt zugeschrieben, die Unerbittlichkeit aber wird von der Gerechtigkeit ausgesagt, die des Werkes allegorische Idee ist. Dadurch braucht die Einheit des Kunstwerkes nicht zu leiden, wenn nur alle diese Gegenstände zu einem Individuum zusammenschmelzen, an einen anschaulichen Träger gebunden sind.
Die Kontemplation ist Voraussetzung aller ästhetischen Wirkung; denn damit die Beschaffenheit eines Gegenstandes uns gefallen oder mißfallen kann, muß sie erst erfaßt sein. Nun kann freilich schon die bloße intellektuelle Beschäftigung mit dem Gegenstande eine gewisse Befriedigung gewähren. Es ist die Lust des Interesses, die wir meinen. Da die ästhetische Einstellung, die Richtung auf die ästhetische Qualität eines Gegenstandes, ein Interesse an seiner merklichen Beschaffenheit in Kraft treten läßt, so ist die Lust des Interesses die aus der Erfüllung einer Intention, einer determinierenden Tendenz, einer Bereitschaft hervorgehende Befriedigung. Aber man darf die ästhetische Wirkung nicht schon in solcher Befriedigung suchen. Man muß sich davor hüten, das Gefällige mit dem Interessanten zu verwechseln, wie es in der modernen Kunst häufig genug geschieht. Das fuhrt zu Seltsamkeiten, aber nicht zu ästhetischen Werten. Andererseits ist das Interesse Voraussetzung für alle ästhetische Reaktion. Das zeigte sich regelmäßig bei Versuchen, in denen ein Bild nicht interessierte und demgemäß auch weder Gefallen noch Mißfallen auslöste (Ritook). Das Ideal der Kontemplation ist erreicht, wenn alle zur merklichen Beschaffenheit des Gegenstandes gehörenden Momente erfaßt sind. Erst dann wird die Bewertung abschließend und gerecht sein. In einseitigem Interesse liegt eine launische Auslese; sie läßt Teile außer Betracht, die gerade nicht anziehen und macht die ästhetische Wirkung voreilig von willkürlich bevorzugten Momenten abhängig. Die Ästhetik als Idealwissenschaft setzt voraus, daß ein allseitiges Interesse dem Gegenstande entgegenkommt, wobei Abstufung nach Haupt- und Nebensachen natürlich nicht ausgeschlossen wird. Adäquate Kontemplation weckt richtiges Verständnis. Der Ausdruck ist hier als der dem Objekt wirklich zukommende gemeint, soweit nämlich die bloße Erscheinung ihn mit Sicherheit ablesen läßt. Es ist höchst gleichgültig, ob ein Schauspieler zornig ist, wenn er nur den zornigen Menschen überzeugend darstellt. Lichtwark hat mit seinen Übungen in der Betrachtung
von Kunstwerken (2. Aufl. 1898) das ästhetische Verhalten namentlich in seinem kontemplativen Stadium sehr geschickt anzuregen verstanden. Er führt z. B. vor ein Bild von Menzel, das Rüstungen in verschiedener Stellung darbietet. Er fragt zunächst nach dem Maler, nach der Technik des Bildes, warum die Rüstungen so hingestellt sind, als ob Menschen darin steckten. Er prüft die einzelnen Gestalten und ihr Verhältnis zueinander. Er beachtet Lichter und deren Reflexe auf den Metallteilen und hebt hervor, wie gerade diese malerische Behandlung den Künstler am meisten fesselt und den künstlerisch gebildeten Beschauer zur Bewunderung hinreiße. Das Beispiel ist auch in anderer Hinsicht lehrreich. Es zeigt nämlich, wie Kunstwerke eine eigentümliche Interpretation herausfordern. Stets wird das Interesse an den Intentionen des Meisters fragen, wieweit es ihm gelungen sie zu verwirklichen. So werden wir erzogen uns zu hüten, daß wir von einem Kunstwerk nicht Wirkungen verlangen, die seinen Schöpfer empört haben würden. So erwächst aus der Ergründung künstlerischer Absicht ein tiefes menschliches Interesse an dem Werk, das uns zu dauernder und hingebender Beschäftigung damit überredet, das vor allem für das Verständnis des anschaulichen Tatbestandes unentbehrlich ist. Wir suchen in dem Aufbau einer dramatischen Komposition den Zusammenhang aller Teile, indem wir voraussetzen, daß in einem aus Menschengeist und Menschenhand hervorgegangenen Werke alles irgendwie planvollen Mitteln seine Entstehung verdankt. Der Natur gegenüber tritt diese Betrachtungsweise zurück, wir fassen sie als ein unergründlich geheimnisvolles Werk und raten nicht eilfertig nach seinem verborgenen Sinn. In Dingen der Kunst aber sehen wir auf die technische Ausgestaltung und beschäftigen uns mit der Frage, wieweit ein Künstler seine Ausdrucksmöglichkeiten dem Material, den Farben, den Tönen, dem Marmor abgerungen hat, wieweit er sich auf die Reize und Sprödigkeiten eben des Materials besonnen hat, wieweit er ihm seine Sonderart unzerstört gelassen hat.
In den kühlen Marmor der Hera Farnese vermögen wir Ruhe, Größe, Macht, Strenge, Ernst einzufühlen; so beseelen wir den Stein. Van Dycks Wilhelm von Oranien wird als vornehm, entschlossen und klug verstanden. Solange wir die Einzelheiten einer Holzfüllung aus Versailles kontemplativ erfassen, bietet sich zur Einfühlung wenig Gelegenheit. Der Blick fällt auf Guitarren, Notenpult und Notenheft. Gleiche Motive wiederholen sich, Symmetrie und dekorative Gruppierung bereiten starke ästhetische Wirkungen vor. Ein fester Rahmen grenzt ein eigenes Reich, in dem sich allerlei phantastische Einfälle tummeln, gegen die übrige Welt ab. Die Symbole der Tonkunst lassen eine musikalische Stimmung miterleben, ohne daß es zu konkreter Einfühlung kommt. Anders wird das, wenn unten im Medaillon eine sitzende, lesende Frauengestalt auffällt, die nach einem Horne faßt. Sie wird als ein Wesen für sich beseelt. Alles übrige erscheint nun ihr untertan. Hier herrscht Frau Musika im Reiche der Töne, Instrumente und Noten. Kinästhetische Vorstellungen sind hier zum Verständnis nicht notwendig. Der Stimmungseinfühlung erscheint das Ornament festlich und belebt die Bewußtseinslage gegenüber historischer Größe, schöner Vergangenheit. Ein dorischerTempel regt die Einfühlung erhabener Strenge an. Die einzelne Säule kann dagegen wohl kaum (wie Lipps will) zum Gegenstande der Einfühlung werden.
Unter der Einfühlung versteht man also die Phase des ästhetischen Zustandes, die das ästhetische Objekt (auch wenn es leblos und vielleicht untermenschlich ist) zum ausdrucksvollen Träger von Leben und Seele, von menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, Zuständen und Tätigkeiten gestaltet. Wir unterscheiden zwischen einfacher und sympathischer Einfühlung; jene projiziert nur gewußte oder vorgestellte seelische Bestimmungen in den Gegenstand, diese läßt uns Zustände oder Ereignisse mehr oder weniger
vollständig und intensiv aktuell miterleben. Für die Entstehung der einfachen Einfühlung gelten im allgemeinen die Reproduktionsgesetze, insbesondere die der Reproduktion auf Grund der Ähnlichkeit des Gegenstandes mit eigenem Verhalten des einfühlenden Subjekts. Für die Entstehung des Miterlebens ist maßgebend, daß lebhaften Gedanken und Vorstellungen die Tendenz zur Aktualisierung der gedachten oder vorgestellten Zustände innewohnt, und daß (wie Lipps gezeigt hat) eine Tendenz zur Nachahmung gegenständlicher Erscheinung besteht. Die Grundrichtung auf den Gegenstand ermöglicht es in beiden Fällen, das eingefühlte Verhalten als dessen Verhalten zu betrachten.
Die Kontemplation ist, wie es zunächst scheint, nichts anderes als die Apperzeption oder Assimilation eines Gegenstandes, die wir auch außerhalb des ästhetischen Zustandes üben. Das Gras als Gras, den Menschen als Menschen auffassen, ohne daß man sich über die realwissenschaftliche Natur dieser Gegenstände dabei klar zu werden braucht, das ist ein im täglichen Leben allenthalben vorkommender Auffassungsvorgang. Die ästhetische Apperzeption unterscheidet sich (wie wir gesehen haben) nur dadurch von der gewöhnlichen, daß sie auch ersonnenen, vorgestellten und gedachten Gegenständen zuteil wird, daß wir keinen Unterschied machen zwischen dem gemalten und dem realen Gegenstande, dem Kunstwerk und dem Naturobjekt, daß der Ausdruck, der sich in den unmittelbaren Beschaffenheiten entdecken läßt, beiden in gleicher Weise beigelegt wird. Die Wirklichkeitsapperzeption bemüht sich zwischen Leblosem und Lebendem, zwischen Unbeseeltem und Beseeltem zu scheiden. Vielfach gelingt ihr das nicht. Es besteht eine schwer zu überwindende animistisch-anthropomorphistische Tendenz; aber jene strebt danach und wird darin von der Wissenschaft auf das Wirksamste unterstützt. Die ästhetische Apperzeption dagegen, die gar kein Interesse daran hat, wirklich Lebendiges und scheinbar Lebendiges, Menschliches und Untermenschliches sorgfältig voneinander zu trennen,
kann dem natürlichen Zuge zur Belebung und Beseelung unbedenklich folgen. Dieser eigentümliche Prozeß ist eben die Einfühlung. Wir trennen ihn von der Kontemplation der klareren Analyse willen. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Ausdruck, den wir aus menschlichen Zügen verständnisvoll ablesen, und demjenigen, den wir in unbelebte Gebilde einfühlen. Das volle Miterleben führt den Kunstfreund erst recht über die Phase der Kontemplation hinaus. Einfache Einfühlung und volles Miterleben sind miteinander so verwandt, daß wir sie zweckmäßig zu einer besonderen Phase des ästhetischen Zustandes zusammenfassen. Das kontemplative Verständnis des Ausdrucks ist ein Akt des Hinnehmens. Der Begriff Einfühlung betont die Selbsttätigkeit des Genießenden, seine Mitwirkung beim Ausgestalten des Gegenstandes. Einfühlung ist (nach Lipps) ein instinktives Sichhineinversetzen in das Objekt, mehr als ein bloßes Verständnis.
Der erste Einfühlungsästhetiker ist wohl Plotinos. Den Romantikern liegt dieser Begriff; Novalis, A. W. Schlegel, Jean Paul theoretisieren in seinem Sinne, schon Herder kann in diesem Zusammenhang genannt werden. Lotze und Fr. Th. Vischer haben die durch Einfühlung bedingte symbolische Natur des ästhetischen Gegenstandes betont. Das Objekt wird so zum Träger inneren Lebens, das sich in seiner Erscheinung ausdrückt. Den Terminus Einfühlung brachte Robert Vischer in seiner Schrift über das optische Formgefühl (1873) auf. Sie ist ihm ein inneres Nacherleben, ein notwendiges Ergebnis jedes sich ungestört vertiefenden Sinneseindrucks. Dabei wird der ganze Leibmensch mitergriffen und das Objekt als etwas menschlich Beseeltes aufgefaßt. Als innere Nachahmung ist dies Nacherleben später von Groos bestimmt worden. Lipps hat zwischen zwei Akten der Einfühlung unterschieden, indem er (wie wir oben) von einfacher und sympathischer Einfühlung spricht. Jene ist vorhanden, wenn wir dem Objekt die eingefühlten Eigenschaften beilegen, diese, wenn wir auch selbst in ihrem Sinne ergriffen sind. Man kann die Gebärde eines anderen als Zorn
oder Sehnsucht deuten, ohne selbst derlei zu erleben; man kann aber mitschwingen. Neuerdings hat Lipps noch zwischen positiver und negativer Einfühlung unterschieden, um den Gegensatz des Schönen und des Häßlichen zu erklären; widerstrebend, nicht miterlebend fühlt man im letzteren Falle ein. Volkelt unterscheidet zwischen eigentlicher Einfühlung, die Menschen gegenüber stattfindet und einer symbolischen Einfühlung gegenüber untermenschlichen Objekten. Diese Unterscheidung hat für die Ästhetik wenig Gewicht. Für die Theorie der Einfühlung hat Lipps am meisten geleistet. Ein ausgezeichnetes Sammelreferat über die Einfühlung hat Geiger im Bericht über den IV. Kongreß für experimentelle Psychologie zu Innsbruck (1910) veröffentlicht. Mit feiner begrifflicher Scheidung spricht er von Ausdrucksverständnis und objektiver Einfühlung, Anthropomorphismus und Miterleben bis zur Einsfühlung. Nicht sehr glücklich ist es, in diesen Zusammenhängen den Ausdruck Projektion zu brauchen, weil er einen besonderen Akt der Verlegung von Gefühlen nach außen voraussetzt. Ein solcher Akt wird niemals bewußt vollzogen. Wir erfassen unmittelbar das Objekt als beseelt, belebt, menschenähnlich, und finden darin Gefühle und Fähigkeiten vor. Übrigens ist eine Beschränkung auf Gefühle im strengen Sinne nicht zu rechtfertigen. Es werden auch andere psychische Elemente, Willensrichtungen, Pläne, Bewußtseinslagen eingefühlt.
Die einfache Einfühlung ist ein an lebenden Wesen, insbesondere an unseren Nebenmenschen allgemein geübtes, unvermeidliches und unbedenkliches Verfahren, wenn auch die wissenschaftliche Erfahrung Tieren und Pflanzen gegenüber zur Behutsamkeit mahnt. Jedenfalls aber überschreitet bei allem Leblosen die ästhetische Einfühlung die Grenzen, die uns sonst gezogen sind, in anthropomorphistischer Richtung. Ich nenne das Veilchen bescheiden, weil sein Blühen im Verborgenen den Eindruck absichtlicher Zurückhaltung machen kann, was beim Menschen als Bescheidenheit erscheint.
Solche Einfühlung würde niemals so lebhaft deuten, so innig verstehen, was das schöne Ding bewegt, wenn uns nicht der instinktive Nachahmungstrieb hülfe, uns die Gebärde der Umwelt nahezubringen. Es ist dabei nicht nötig, daß die unwillkürlich intendierte Nachahmung auch noch, wie beim Kinde, ausgeführt wird. Sieht uns jemand freundlich oder frostig an, so sind wir geneigt, ihm mit gleicher Miene zu begegnen, obwohl wir uns diesem Triebe gegenüber auch beherrschen können. Das Kind ahmt Tiere und Puppen in Haltung und Bewegung nach und erregt so in sich Gefühle, Stimmungen, Vorstellungen, die doch nicht als eigene erlebt, sondern als fremde im äußeren Gegenstande nur miterlebt werden. So wird es möglich, auch die scheinbar fernstliegenden Gebärden der Erscheinung zu enträtseln. Vorwiegend wird die Nachahmungstendenz optischen Gegenständen gegenüber wirksam. Töne können wiederum Gemütszustände erregen, die dann vergegenständlicht werden und in die Kunstform der Musik einströmen. In diesem Falle führt der Weg nicht von der Gebärde zur Erregung sondern von der Erregung zur Ausdrucksform. Auch hier verlebendigt eine Tendenz, Rhythmen und Laute nachzubilden, die Stimmung der Tonwelt. Bestimmte Erfahrungen mit den Dingen vertiefen die Einfühlung. Wer schlimme Gewitter erfahren hat, spürt empfindlicher, wie drohend eine Wolkenwand sein kann. Auch hier wäre eine gründliche Untersuchung all solcher animistisch-anthropomorphistischer Prädikationen sehr wünschenswert.
Je vertiefter die ästhetische Konzentration, desto lebhafter wird die Einfühlung sein, um so unmerklicher wird aus der einfachen Einfühlung die sympathisch miterlebende. Ich selbst bin dann ergriffen von der Stimmung, die erst für mich nur im ästhetischen Gegenstande waltete. Auf mir lastet dann die Beklemmung, mich erfassen Furcht und Ehrfurcht. In tiefer Kontemplation scheide ich nicht mehr zwischen mir und dem Objekt, sondern ich gehe in ihm auf. Die Grundrichtung meines Geistes gehört ihm; es lenkt
meine Aufmerksamkeit und mein Interesse allein auf sich, meine Zustände werden die seinen. Sie werden so vergegenständlicht. Ich kann dem ästhetischen Objekt diese Zustände zuschreiben, weil seine Erscheinung dazu paßt, weil sie ihr Träger sein kann. Solche Innigkeit der Einfühlung wird besonders bei dramatischen Szenen lebhaft. Das ästhetische Verständnis wird tiefer und lebhafter bei solch sympathischer Einfühlung, die schließlich bis zu völliger Einsfühlung wachsen kann.
Man hat sich in letzter Zeit viel darum gestritten, wie Einfühlung entsteht, ob der Prozeß der Einfühlung schließlich auf Assoziationen zurückgeführt werden kann, oder ob Einfühlung nicht aus Assoziationen erklärt werden kann, wie namentlich Lipps mit beachtenswerten Gründen behauptet. Die Entscheidung darüber ist nicht leicht zu geben. Wir müssen es vorläufig dahingestellt sein lassen, ob Nachahmungstendenz und Vergegenständlichung unter den Begriff der assoziativen Reproduktion fallen oder nicht. Es ist darum zur Zeit sicherlich richtiger, die Prozesse vollständig zu beschreiben, als sie voreilig auf einen Grundprozeß, auf ein Grundgesetz zu reduzieren. Vielleicht ist doch da, wo eine Nachahmungstendenz nicht rege wird, schon eine Art vererbter Anlage mit Lipps zu vermuten, eine Anlage für das Verständnis wahrgenommener Formen und Haltungen wirksam. Zu diesen Fragen einer psychologischen Ästhetik vgl. man auch Meumanns Ästhetik der Gegenwart und Stern über Einfühlung und Assoziation.
Die sympathische Einfühlung, das aktuelle Miterleben tritt im allgemeinen später in das ästhetische Verhalten ein als die einfache Einfühlung. Versuche nach der Methode der Zeitvariation an Projektionsbildern haben das dargetan. Bekanntschaft mit dem Kunstwerk kürzt die Dauer dieses Prozesses ab. Ob es sich auch bei der Musik so verhält, kann zweifelhaft sein. Beide Einfühlungsarten können abweichende Beschaffenheit und Richtung haben. Ich kann eine Musik traurig nennen, ohne daß sie mich traurig stimmt.
Sodann besteht zwischen einfacher und sympathischer Einfühlung der wichtige Unterschied, daß diese viel enger und begrenzter ist als jene. Man kann nicht mit mehreren dramatischen Gestalten zugleich innerlich mitleben, dagegen kann man leicht verschiedene seelische Inhalte in sie projizieren. Man kann Maria Stuarts echte königliche Vornehmheit und die Herrschsucht, Eitelkeit und Rachgier Elisabeths in die Darsteller einfühlen. ferner hat das Miterleben seine Grenze an dem Inhalt der mitzuerlebenden Zustände. Es gibt vieles, was ich vermöge meiner seelischen Struktur nicht miterleben kann, ohne daß mein Verständnis und damit die einfache Einfühlung zu versagen brauchte. Endlich bleibt der Grad des Miterlebens häufig hinter dem Eingefühlten zurück: Verzweiflung, Zorn, Haß, Entzücken, Begeisterung und Liebe werden nicht bis zu Rausch und Taumel mitgelebt. Gedankliches Mitmachen und Miterleben sind zu unterscheiden. Aus diesen Gründen darf man die ästhetische Wirkung nicht einfach von der sympathischen Einfühlung abhängen lassen.
Nicht nur zwischen einfacher und sympathischer Einfühlung tun wir gut zu trennen, auch abstrakte und konkrete Einfühlung rücken wir zweckmäßig einander gegenüber. Die Einfühlung ergänzt den uns bis dahin äußerlichen Gegenstand, über das Verständnis des Ausdrucks hinaus beseelend und belebend. Dabei wird unwillkürlich die Erscheinung nach dieser ihrer Bereicherung mit seelischen Zuständen, Vorgängen und Fähigkeiten zu einem persönlichen Wesen. Dann wird die Einfühlung zur Personifikation oder zur konkreten Einfühlung. Am einfachsten ist das bei optischen Gegenständen zu erkennen, besonders bei menschlichen Erscheinungen. Hier sind die anschaulich gegebenen Haltungen und Gebärden der einfachen und der sympathischen Einfühlung in der angedeuteten Weise zugänglich. Bei untermenschlichen Gegenständen ist die Ähnlichkeit mit eigenen Stellungen und Bewegungen, mit eigenen Mienen und Lauten die wirksame Grundlage für die persönliche Einfühlung.
Je unmittelbarer und anschaulicher, greifbarer und deutlicher diese Ähnlichkeit ist, um so leichter und vollständiger wird sich auch die konkrete Einfühlung entwickeln. Dabei ist es irrelevant, ob die Objekte wirkliche Dinge oder nur dargestellt sind. Die bildende Kunst hat es in der Hand, die Ähnlichkeit herauszustreichen und damit dem Einfühlungsprozeß einen kräftigen Impuls zu geben, anders die dekorative Kunst und die Architektur. Hier kann die Ähnlichkeit mit einem mir gleichenden persönlichen Wesen verschwindend gering sein; aber dafür wird ein einzelnes Motiv zum Symbol von menschlichen Zuständen. Es ist, als ob eine Persönlichkeit durch solche Zeichen ihre Zustände kundgebe, ohne doch selbst in der Erscheinung gegeben zu sein. Wenn ich ein ornamentales Motiv betrachte, so kann ich mich darein abstrakt einfühlen. Seine Stimmung verspüre ich, aber ich personifiziere es nicht. In diesem Sinne hat ein Rokoko-Ornament Anmut, ein gotisches Feierlichkeit, ein barockes ungebundene Kraft, ein Renaissance-Ornament hohe Festlichkeit. Hier noch von konkreter Einfühlung zu sprechen (wozu Lipps neigt) scheint mir nicht berechtigt.
Diese abstrakte Einfühlung wird vorzugsweise in der absoluten Musik geübt. Es wäre absurd, die eingefühlten Stimmungen auf die Orchestermitglieder übertragen zu wollen oder sie dem fernen Komponisten anzusinnen. Keinesfalls werden die Töne personifiziert. Man braucht sich auch keinesfalls Wesen vorzustellen, denen man jene Stimmungen beilegen könnte. Zuweilen weist uns ja der Komponist in diese Richtung (Beethovens Eroica). Aber man braucht keine Phantasien dergestalt auszuspinnen. Die abstrakte Einfühlung genügt. Wir fassen die innige Vereinigung von Melodien, Rhythmen und Harmonien geradezu als Erscheinungen innerer Zustände, als Sehnsucht und Erfüllung, Jubel oder Verzweiflung, Trauer und Erhebung. Man braucht nur Berichte über musikalische Eindrücke zu lesen. überall begegnen einem Angaben solcher Stimmungen und Gefühlsverläufe, die an keinerlei persönliches Substrat gebunden sind, son-
dern die lediglich in die Erscheinung, die sie ausdrückt, verlegt, in ihr vergegenständlicht werden. Damit ist der Idealisierung weitester Spielraum eröffnet. Je mehr wir uns von der konkreten Wirklichkeit bestimmter Wesen mit bestimmt gearteten Zuständen entfernen, um so weniger sind wir gezwungen, dem wirklich Erlebten Rechnung zu tragen. Natürlich ist die Grenze zwischen konkreter und abstrakter Einfühlung nicht so scharf zu ziehen, daß wir etwa jene als voll ständig, diese als unvollständig zu bezeichnen hätten. Die konkrete ästhetische Einfühlung ist immer noch abstrakt im Vergleich mit der beseelenden Apperzeption, die wir im Leben üben. Auch die bildende Kunst, die zu konkreter Einfühlung mit am meisten herausfordert, gibt dem Gesichtssinn von Fall zu Fall nur eine Ansicht. Die gesteigertste konkrete Einfühlung erlaubt die dramatische Aufführung. Aber selbst bei dem Musikdrama, dem Gesamtkunstwerk, wird durch die Beschränkungen auf die höheren Sinne, auf Handlungsausschnitte und erlesene Hauptpersonen dafür gesorgt, daß die volle Wirklichkeit außer Betracht bleibt, während die Stoffwahl erst recht die Distanz wahrt, die der ästhetischen Kontemplation förderlich ist.
Wie steht es bei alledem um die psychische Vergegenwärtigung der eingefühlten Modi? Wissen und Vorstellen bringen uns die eingefühlten Zustände in der einfachen Einfühlung nahe. Wir können uns die an Haltungen und Bewegungen, an Formen und Rhythmen gebundenen inneren Zustände als Komplexionen von Organempfindungen sehr gut vorstellen, und wir können ein mehr oder weniger deutliches Wissen von den Gefühlen haben, die sich daran knüpfen. Ob es auch eine vorstellungsmäßige Vergegenwärtigung von Gefühlen gibt, ist eine noch nicht entschiedene Frage. Manche Psychologen und Ästhetiker nehmen es unbedenklich an. Ich bin geneigt, es in Abrede zu stellen. Aber zweifellos kann man sich alles vorstellen, was irgend in Empfindungen aktuell gegeben war, wie namentlich auch, was in Organempfindungen aktuell einmal erlebt wurde.
Und da diese Organempfindungen in Affekten und Stimmungen mit vorwiegen, so ist auch eine vermittelte Vorstellung von ihnen möglich. Insoweit kann man sich Spannung und Erregung, Unwillen und Verdruß, Heiterkeit und Bewunderung, Ehrfurcht, Angst und vieles andere vorstellen. Das Miterleben, die innere Nachahmung solcher Zustände wäre meist zu schwach, um eine adäquate Vergegenwärtigung zu bilden. Es muß die Bewußtheit um ihre Bedeutung hinzukommen, und es kann die bildliche Vorstellung mitwirken. Wie diese verschiedenen Faktoren zusammenfließen, um eine lebhafte Einfühlung, einen wirklichen Anteil am ästhetischen Gegenstande hervorzubringen, ist noch nicht genügend geprüft. Hier bleibt der experimentellen Analyse noch ein weites Feld offen.
Wie wir sahen, entspricht die Einfühlung einer ursprünglichen animistischen Tendenz, einem naiven Anthropomorphismus, wie er sich bei Kindern und Wilden deutlich ausgeprägt findet. Wir sind geneigt, alles nach Maßgabe seiner Verwandtschaft mit uns und unserer Erfahrung aufzufassen, alles was wir bei solcher Lage, Form, Bewegung empfinden würden, dem Gegenstande beizulegen. Aber es fehlt dem ästhetisch Genießenden die praktische Bedeutung animistischer Vorstellungen. Wohl wird ein inneres Leben eingefühlt, aber keine praktische Beziehung wird dazu eingenommen, es bleibt alles beim kontemplativen Erlebnis. Andererseits kann sich darum die Belebung und Beseelung weit freier und vollständiger entfalten, weil die praktische Rücksicht auf Nutzen und Schaden, weil Furcht und Hoffnung und andere dem Animismus innewohnende Hemmungen zurücktreten. Durch den Einfühlungsprozeß wird die qualitative Fülle des Gegenstandes sehr bereichert, wird auch das Interesse an ihm und seiner Beschaffenheit, die spezifisch ästhetische Einstellung und Richtung auf ihn verstärkt. So bildet sich ein enger Zusammenhang aus zwischen den einzelnen Stadien des ästhetischen Verhaltens.
Die Innigkeit der Verbindung des Eingefühlten mit dem
Gegenstande ist häufig betont worden. Man hat dies ins Feld geführt für die Annahme, daß es sich hier um Assoziationen handele. Diese Innigkeit beruht zunächst darauf, daß die eingefühlten Kräfte, Eigenschaften und Zustände sämtlich unselbständige Gegenstände sind. Wir können sie zwar in faktischer Abstraktion auffassen, wie in der dekorativen Kunst oder in der Musik; aber dann bedürfen sie doch der Stütze eines Symbols, wir gießen sie in das Gefäß des Tones. Sie müssen somit auf irgend welche selbständigen Gegenstände oder Symbole bezogen werden. Ich kann nicht Bescheidenheit, Heiterkeit, Spannung, Furcht als solche für sich vorstellen, sondern immer nur als Ausdruck oder Zustand von etwas. Ich erlebe alle diese seelischen Vorgänge oder Fähigkeiten als meine Vorgänge oder Fähigkeiten, wenn ich sie nicht auf Objekte beziehen oder sie als Fähigkeiten anderer auffassen kann. Sonst bleibt nur noch, sie als inneres Sein eines Äußeren, einer wahrnehmbaren Erscheinung zu verspüren. Niemals gelingt eine faktische Loslösung von solchen Grundlagen; daß ich logisch von diesen absehen kann, versteht sich, erklärt hier aber gar nichts. Die Munterkeit eines plätschernden Baches, die widerstrebende Kraft einer lastentragenden Säule, das Schluchzen und Jauchzen der Nachtigall, das alles sind unselbständige Gegenstände. Eingefühlt werden sie in zu ihnen passende selbständige Gegenstände. Es besteht damit der denkbar engste Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und den eingefühlten Eigenschaften; es sind eben die seinigen. Im Verein bilden sie erst den eigentlichen reichen, erfüllten Gegenstand. Die eingefühlten Stimmungen sind nicht zufälliges Beiwerk, sondern um so notwendiger dem beseelten Dinge verschmolzen, je tiefer der Zustand der ästhetischen Kontemplation ist. Versenken wir uns in die Betrachtung eines meisterhaften Porträts und wählen etwa Raffaels Bild des zweiten Julius, so fordert jeder einzelne Zug zur Einfühlung heraus. Keine Erscheinung, die nicht beseelt wäre, nichts Seelisches, das nicht auch erschiene. Hier waltet ein psychophysischer Pa-
rallelismus – fast möchte man sagen ein ästhetischer Monismus – ; denn nicht nur Haupt und Haltung, die Linien von Antlitz und Händen zwingen zur Belebung, auch die Ringe an den Fingern sprechen noch mit von Gerechtigkeit und Strenge, verständnisvoller Würdigung des Menschen und der Welt, Innerlichkeit und Beschaulichkeit.
All diese Gedankengänge zwingen uns zu der Überzeugung, daß in der Einfühlung nicht nur Gefühle im weiteren Sinne, sondern überhaupt seelische Vorgänge, Tätigkeiten und Fähigkeiten vergegenständlicht werden. Man kann jemanden phantasievoll, tiefdenkend, energisch, vornehm, sinnlich finden, ohne damit nur Gefühle auszusagen. Einzelne Vorstellungen und Gedanken wird man nur aus einer poetischen, nicht aus einer malerischen Situation heraus erkennen. Aber auch die bildende Kunst verrät psychische Gesamtqualitäten, Bewußtseinslagen, intellektuelle und volitionale Gaben mit Sicherheit durch die bloße Erscheinung ihrer Werke. Besonders deutlich tritt das eben bei Bildnissen hervor. Die Offiziere der Adriansgilde auf dem Bilde von Frans Hals rufen nicht eben einen Sturm von Gefühlen hervor; die Charakteristik von Persönlichkeiten erschöpft sich nun einmal nicht in emotionalen Eigenschaften und Fähigkeiten. Auch ihr Beruf, ihre Erfahrung, ihr Talent prägt sich schon in ihrer Erscheinung aus. Was wesentlich und dauernd zur Persönlichkeit gehört und nicht zufällig einen Augenblick lang durch ihr Bewußtsein zieht, kann so hervortreten. Wesentlich ist die Feststellung, daß Charakter kein Gefühl sondern eine Beschaffenheit des Gegenstandes ist. Von Charakter in diesem Sinne spricht Geiger in seinen Untersuchungen zum Problem der Stimmungseinfühlung (Zeitschr. f. Ästh., Bd. 6). Schon an der Heiterkeit und Schwermut einer Farbe unterscheidet er das subjektive Stimmungserlebnis, den objektiven Gefühlsbestandteil, der die Gegenstände umfließt, und schließlich den Gefühlscharakter, der ihnen zukommt. Auch Schultze (Arch. f. d. ges. Psych., 1906, Bd. 8, S. 339ff.) hat mit seinem Begriff des Wirkungsakzents ver-
sucht, gleichartige Tatsachen zu beschreiben. Vgl. auch Bullough (Brit. Journ. of Psychol., Bd. 2 u. 3).
Wenn man den Reichtum, den die Einfühlung ausschüttet, auch über die Schätze des Gefühls hinaus unerschöpft findet, so ist damit nicht behauptet, daß ästhetische Kontemplation uns einzelne Gedanken und Vorstellungen kunsterschaffener Menschengebilde verraten kann, wenn sie nicht ein Dichter ausplaudert. Niemand wird behaupten, in den Gedanken des Pensieroso lesen zu können, obwohl ihm der Charakter der Nachdenklichkeit an die Stirne geschrieben ist. Was sich nicht eindeutig einfühlen läßt, hat auch nichts mit dem ästhetischen Gegenstand gemein. Was ich mir assoziativ als Gedanken des Pensieroso einfallen lasse, verschönt nicht das Werk des Michelangelo. Wem ein Satz einer Beethovenschen Sonate den Zug der trojanischen Frauen zum Tempel der Athena (Ilias, Os. 9) darstellt, der hängt nur seinen vagen Träumereien nach und vertieft das Verständnis Beethovens nicht. Der Ausdruck der Musik ist unabhängig von solchen Untersuchungen.
Die von Geiger hervorgehobene Einsfühlung darf also nicht dahin verstanden werden, daß nun jeder Kunstfreund in den ästhetischen Gegenstand hinein sein übervolles Herz ergießen solle. Die Einheit zwischen Gegenstand und Zustand des ästhetischen Verhaltens, zwischen genießendem Ich und genossenem Objekt, diese Einsfühlung darf nicht zu sehr überspannt werden. Sie darf nicht die Gegenständlichkeit des Kunstwerks oder des ästhetischen Objekts preisgeben. Sie ist darum mehr ein negatives als ein positives Merkmal. Es fehlt im ästhetischen Verhalten an der geläufigen Scheidung zwischen Ich und Nicht-Ich, zwischen Wirklichkeit und Schein, zwischen bewußtem Sein und der Realität selbständig existierender Objekte. Man darf auch wiederum nicht auf die Übertreibung verfallen, es seien alle Einfühlungsprozesse auf die Grenzen des eigenen Erlebens beschränkt. So wenig das Ausdrucksverständnis davon allein abhängt, daß ich den Zusammenhang von Erscheinung und
Ausdruck an mir selbst erfahren habe, so wenig braucht die Einfühlung vorauszusetzen, daß die eingefühlten Zustände, Akte und Fähigkeiten in dem einfühlenden Subjekt selbst ihren Sitz haben. Sonst müßte die Individualität des Einfühlenden entweder die Einfühlung außerordentlich einschränken oder mit unabsehbaren individuellen Koeffizienten belasten. In einfacher Einfühlung kann man durchaus über die Grenzen der eigenen Individualität hinausgehen. Der Schwächliche kann auch Energie, der Pedant auch Ungebundenheit des Lebens, der ruhig Empfindende das wilde Auf und Ab leidenschaftlicher Gemüter einfühlen und anderen Persönlichkeiten beilegen. Aber auch beim Nacherleben, bei sympathischer Einfühlung ist das möglich, da wir im ästhetischen Verhalten von der Gewohnheit und Geschlossenheit unseres Lebens frei und unabhängig werden und die Fähigkeit haben, einen viel weiteren Bereich von seelischen Zügen und Tendenzen in uns zu verwirklichen, als sie unter den realen Bedingungen der Selbsterziehung und Fremderziehung, der Aufgaben und Richtungen unseres Daseins in uns wirksam großgeworden sind. Unsere Anlagen reichen weiter als unsere Leistungen, unsere Bestimmbarkeit ist umfassender als unsere Bestimmtheit, unser Gemüt ist tiefer als unsere täglichen Gefühle, unser Geist weiter als die uns vergönnten Gedanken, unser Wille edler als die vollbrachte Handlung, unsere Fassungskraft umspannt nicht nur die Welt der nüchternen Wirklichkeit. So lassen sich noch solche Personen, Zustände und Vorgänge miterleben, die von unserem Charakter mehr oder weniger stark abweichen. Darin liegt die Ausweitung begründet, die wir dem ästhetischen Verhalten verdanken, zugleich aber auch die Gefahr, die es für schwache Naturen in sich schließt, daß sie sich verlieren, um Romanphantasien nachzujagen. Die reproduzierende Kunst des ausübenden Musikers, des Rezitators, des Schauspielers wäre ohne die hier gekennzeichnete Ausdehnung des Ausdrucksverständnisses gar nicht möglich. Man braucht nicht Wallenstein oder König Lear zu sein oder zu werden,
um sie darstellen zu können. Man braucht nicht emotional erregt zu sein von dem Gedanken, den ein Gedicht ausdrückt, um es gut vortragen zu können. Man wird die emotionalen Erregungen eines Musikwerks auch dann vermitteln können, wenn man sie selbst nicht miterlebt. Darum unterscheidet man zwischen Ernst- und Phantasiegefühlen; aber man darf dabei nicht vergessen, daß die Phantasiegefühle keine vollständigen Gemütserregungen sind. Für Zuschauer und Zuhörer genügt durchaus die Haltung des Als-Ob (Vaihinger). Der Künstler spricht, spielt oder singt, als ob er alles das wirklich fühlte, was in seiner Darstellung enthalten ist.
Die Analyse der Einfühlung macht es wiederum verständlich, daß es nichts in der Welt und auf Erden gibt, was nicht ein ästhetisches Verhalten ermöglichen könnte. Jedes Erlebnis kann ästhetischer Gegenstand werden, Einfühlung in jeden Gegenstand ist möglich. Der Mensch erweist sich gerade darin als der Mikrokosmos, daß er alles aus seiner Erfahrung zu deuten vermag und so zum Maß aller Dinge wird. Der Wert, der an den eingefühlten Zuständen hängt, geht damit auch in das ästhetische Verhalten ein. So lassen sich jederzeit außerästhetische Werte in ästhetische umwandeln, und diese Umwandlung ist von außerordentlicher Bedeutung für die Wirksamkeit der Kunst. Zur Wirklichkeit kann ich mich auch anders verhalten als ästhetisch, ich kann sie wissenschaftlich, technisch, praktisch behandeln; aber der Kunst gegenüber ist das ästhetische Verhalten adäquat, der ästhetische Gesichtspunkt wird vorherrschend, die anderen Werte ordnen sich ihm unter. Sie brauchen dabei ihren spezifischen Wertcharakter nicht zu verlieren; nur anhaftende Unwerte werden gemildert und gemäßigt. Das Häßliche, Schlechte, Unscheinbare, Traurige in der Wirklichkeit kann dadurch kontemplativ genossen werden. Dem ethischen Verhalten, das in der realen Welt durch Unglück, Armut, niedrige Gesinnung, Mord empört wird, steht in der Kunst das ästhetische gegenüber, das uns alle diese Dinge, zumal in dramatischer Form, betrachten und genießen läßt. So
versetzen wir uns in die Seele des Verbrechers und nehmen kontemplativ Anteil an seinen Schicksalen. Freilich gelingt es nicht immer, das sittliche Urteil zurückzuhalten. Der naive Mensch wird mit dem Guten, Heldenhaften, Harmlosen so lebhaft mitempfinden, daß sein Abscheu gegen das Schlechte, Schädliche, Gemeine über die Grenzen der ästhetischen Kontemplation hinausgehen kann. Er wird verlangen, daß es dem Guten schließlich gut, dem Schlechten schließlich schlecht ergehen soll; er wird nicht zwischen ethischer und ästhetischer Motivierung zu unterscheiden wissen. Gewisse Romane und Dramen rechnen denn auch geradezu auf die mangelhafte Bildung des großen Publikums. Vollends sind die sogenannten Volksstücke erfüllt von einer ästhetisch nicht gerechtfertigten sog. „sittlichen Weltordnung“. Da tut es Not darauf hinzuweisen, daß ästhetisches und ethisches Verhalten ganz verschieden sind, und daß Kunstwerke nicht dazu bestimmt sind ethisch, sondern ästhetisch zu befriedigen. Das ästhetische Verhalten verleiht seinen Gegenständen einen eigentümlichen Wert, der in der Wirklichkeit ihnen nicht anhaftet. Wenn Madame de Staël gesagt hat „tout comprendre, c’est tout pardonner“, so ist das kein ethischer, sondern recht eigentlich ein ästhetischer Satz, ein Spruch ästhetischer Gerechtigkeit. Indem wir einfühlen und miterleben, geht uns die Möglichkeit eines solchen Verhaltens auf, und so wird das Verstehen zum Erklären und damit zum ästhetischen Rechtfertigen aus den Bedingungen und Voraussetzungen heraus. So mildert die ästhetische Gerechtigkeit die Härten und Schärfen der ethischen und rechtlichen. Daraus begreift sich zugleich die große Bedeutung der Kunst für die Entwicklung der menschlichen Anschauungen. Wir lachen über menschliche Fehler und Schwächen bei komischer Darstellung, gewinnen eindringenderes Verständnis in ernsthafterer Darstellung. Zugleich wird unser sittliches Urteil maßvoller und zurückhaltender. Die große Wandlung in unseren sozialen Anschauungen, in unseren Urteilen über Vergehen und Strafe ist sicherlich nicht
nur auf wirtschaftliche Veränderungen und politische Revolutionen zurückzuführen. Die innere seelische Stellungnahme kann daraus allein nicht abgeleitet werden. Vielmehr haben dazu ganz wesentlich künstlerische Darstellungen beigetragen. Solche Linderung und Vertiefung wirkt die Einfühlung; vom Einfühlenden gilt das Wort des Terenz: homo sum, nil humani a me alienum puto.
Die Wertgefühle des Gefallens und Mißfallens bilden die ästhetische Wirkung im engeren Sinne, sie hängen von Gegenstand und Zustand in gesetzmäßiger Weise ab. Außer diesen Gefühlen herrschen im ästhetischen Zustande noch teilnehmende Gemütserregungen. Die teilnehmenden Gefühle treten nur bei menschlichen Gegenständen und genauerem Einblick in deren Schicksal hervor. Allgemeine Bedingung für Auftreten und Lebhafügkeit dieser beiden Arten von Reaktionsgefühlen ist, daß ein Gegenstand durch Eigenart, fülle und geistige Anregung eine intensive Beschäftigung des ganzen Subjekts einleitet und unterhält.
Die am ästhetischen Verhalten beteiligten Gefühle kann man in zwei große Klassen teilen: in die vergegenständlichten und die zuständlichen (die Volkelt als „persönliche“ bezeichnet). Die letzteren haben wir deshalb Reaktionsgefühle genannt, weil sie eine Reaktion des in Kontemplation befindlichen Subjekts auf den Gegenstand bilden. Unter diesen zuständlichen Gefühlen, die man als ästhetischen Genuß zusammenfaßt, hatten wir wiederum zwei Gruppen vorgemerkt: die teilnehmenden und die Wertgefühle. Unser teilnehmendes Gefühl fürchtet für Egmont, bemitleidet Medea, verabscheut Richard III., trauert über den Untergang Gretchens. Alle derartigen Gemütszustände werden nicht vergegenständlicht sondern im ästhetischen Zustande erlebt. Sie werden als Wirkung des eindrucksvollen Gegenstandes auf uns, die Betrachtenden, aufgefaßt. Von den eingefühlten Stimmungen lassen sie sich leicht unterscheiden, wenn wir
uns fragen, ob wir sie auf das Objekt selbst übertragen könnten. Das Mitleid, das wir für Medea fühlen, wird ihr selbst nicht zugeschrieben. Die teilnehmenden Gefühle sind von Wichtigkeit für die ästhetischen Modifikationen (für das Tragische, Erhabene, Komische usw.), sofern sie allgemein entfesselte Wirkungen des Gegenstandes sind und nicht bloß auf zufälliger Veranlagung oder Disposition beruhen. Auch die Rührung gehört zu diesen teilnehmenden Zustandsgefühlen. Sie ist namentlich in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts stark berücksichtigt worden. Das Gefühl des Interesses, das man wohl auch als Reiz bezeichnet hat, ist gleichfalls hierher zu rechnen. Volkelt hat mit Recht bemerkt, daß die teilnehmenden Gefühle bei menschlichen Gegenständen am stärksten anklingen, während sie bei untermenschlichen abnehmen. Man kann hinzufügen, daß sie um so stärker sind, je mehr wir von diesen Menschen, ihrem Charakter und Schicksal erfahren. Dramen und Romane sind die Haupterreger teilnehmender Gefühle. Ihnen kommt für die Ästhetik keine so große Bedeutung zu wie den Wertgefühlen. Sie sind keine spezifisch ästhetischen Zustände, sondern natürliche Reaktionen eines für Lust und Leid, Größe und Niedrigkeit, Güte und Roheit empfänglichen Gemüts. Das ästhetische Verhalten löst sie los von dem Boden egoistischer Rücksicht und befreit sie von allen Willensfolgen. Sie werden zu bloßen Zuständen eines Unbeteiligten, Unparteiischen und damit ästhetisch verwertbar. Im übrigen können sie recht intensiv und mannigfaltig sein; ja vielen mögen sie als der eigentliche Maßstab tiefgehender ästhetischer Wirkung erscheinen. Keinesfalls ist es richtig, daß sie für den ästhetischen Wert entscheidend sind.
Die zweite Gruppe der Zustandsgefühle bilden die Wertgefühle des Gefallens und Mißfallens, vermöge deren wir etwas schön oder häßlich nennen. Sie knüpfen sich an den ästhetischen Gegenstand, an die Kontemplation, an die Einfühlung, sowie an die Teilnahmegefühle; nur in abstracto sind sie davon ablösbar. Auch ist ihre Entfaltung wesentlich
davon abhängig, daß man sich nicht ausdrücklich mit ihnen abgibt. Richtet man die Aufmerksamkeit auf die Gefühle selbst, so schwächen sie sich ab und entschwinden. Sie gehören zu jenen Geistern, die nur ungerufen kommen und nur unbeobachtet wirken. Die Wertgefühle sind Zustände der Lust und der Unlust. Wir sind im Gegensatz zu der Ansicht mancher Psychologen der Überzeugung, daß sich diese ästhetische Lust und Unlust qualitativ von anderer Lust und Unlust nicht unterscheidet und daß man ihr daher nicht ohne weiteres ansehen kann, ob sie ästhetisch ist oder nicht. Ihre Besonderheit liegt darin begründet, daß sie als Totalreaktion den ganzen Menschen erfüllen, also kein einfacher Teilinhalt des Bewußtseins sind, außerdem in ihrer Entstehung. Daß sie den ganzen Menschen erfüllen, stimmt zum Begriff des ästhetischen Verhaltens. So unterscheidet sich das ästhetische Gefallen insbesondere von den gewöhnlichen sinnlichen Gefühlen, die aber sehr wohl mit darin eingehen können. Für die sinnlichen Gefühle ist die Abhängigkeit von der Intensität der Reize kennzeichnend, das ästhetische Gefühl ist eben nicht vom Reize, sondern vom ästhetischen Eindruck abhängig, von dem nämlich, was durch verständnisvolle und empfängliche Auffassung aus dem Reize geworden ist. Diese Abhängigkeit von der Kontemplation ist zugleich geeignet, die ästhetischen Wertgefühle gegenüber den sittlichen und intellektuellen Gefühlen abzugrenzen. Eine Handlung erregt unser sittliches Wohlgefallen, wenn sie aus einer von uns gebilligten Gesinnung hervorgeht; ob sie gefällig aussieht, ist dabei gleichgültig. Unser intellektuelles Wohlgefallen wird durch richtige und wahre Behauptungen belebt, durch konsequente Schlüsse und zutreffende Theorien. Ob die Gedanken dabei schwerfällig ausgedrückt sind, das ist irrelevant. Aber die intellektuellen und sittlichen Gefühle können sich dem ästhetischen Verhalten einordnen. Dann tragen sie den Charakter teilnehmender Zustandsgefühle, wie Anerkennung und Verwerfung und färben die ästhetische Auffassung. Wenn Aristoteles die Freude an dem Kunstwerk auf eine gelungene
Erkenntnis glaubte zurückführen zu dürfen, so hat er übersehen, daß eine solche nur im Dienste des ästhetischen Verhaltens zu ihm etwas beiträgt. Es fördert das Verständnis des Kunstwerks, wenn wir wissen, was es darstellt, aber die Zurückführung des Nachbilds auf ein Urbild ist nicht Selbstzweck, sondern bestenfalls Hilfsmittel.
Gefallen und Mißfallen sind also geknüpft an die Beschaffenheit des ästhetischen Gegenstandes und an die Einfühlung. Welche Beschaffenheiten unmittelbar gefallen, welche mißfallen, wird erst später zu untersuchen sein, wenn wir von Symmetrie, Proportion, Farbenreinheit, Harmonie reden. Hier muß die Analyse besondere virtuelle Wirkungen feststellen. Die Gesetze der ästhetischen Wirkung werden nur aus genauen Einzeluntersuchungen einleuchten. Außerdem wird die Einfühlung zum Ursprung von Wertgefühlen, je mehr sie den Gegenstand bereichert. Auch das Miterleben ist noch eine Quelle ästhetischer Gefühle. Es kann gefallen oder mißfallen. Nach Lipps ist es angenehm, wenn ein beglückendes Sympathiegefühl aufstrahlt, wenn wir ungehemmt einfühlen. Nach Groos gefällt uns das Spiel der inneren Nachahmung ganz unabhängig, scheint’s, von der Beschaffenheit des Nachgeahmten. Auf das Miterleben geht zu einem Teil die Katharsis des Aristoteles zurück, auch das freie Spiel der Erkenntniskräfte nach Kant. Die Teilnahme am Gegenstande ist ebenfalls von Bedeutung für die Wertgefühle. Sie kann diese geradezu nach sich bestimmen. Liebe und Haß, Bewunderung und Verachtung drücken den Wertgefühlen nur zu leicht ihren Stempel auf. Da sie aber keine spezifisch ästhetische Bedeutung haben, so gefährden sie die Reinheit des ästhetischen Verhaltens. Der Wert eines Dramas ist davon unabhängig, ob seine handelnden Personen uns sympathisch sind oder nicht. Eine Vermischung des ethischen und des ästhetischen Urteils fruchtet in keiner Weise. Deshalb ist es doch nicht geraten, etwa alle Teilnahme auszuschalten oder gegen ihre Stellungnahme schroff aufzutreten. Hier liegt vielmehr ein schwerwiegendes Problem vor, das
nicht einfach umgangen werden darf. Inwieweit, so fragt es sich, soll mit der Teilnahme gerechnet werden, wie eng darf das ästhetische Urteil sich ihr anschließen? Hier beschränken wir uns darauf zu sagen, daß der ästhetische Wert eines Kunstwerks nicht von dem Inhalt der teilnehmenden Gefühle, wohl aber von ihrem Verlauf und ihrem Zusammenhang mit dem übrigen ästhetischen Verhalten abhängt. Tiefe, starke Teilnahme ist gewiß zu wünschen; aber die Empörung über unsittliche Taten bestimmt ebensowenig wie Freude am Guten den Wert eines Dramas. Tränen des Mitleids und der Ergriffenheit sind kein Kriterium einer guten Tragödie und zwerchfellerschütterndes Lachen kein Kriterium der wertvollen Komödie. Nur sofern beide ästhetisch motiviert sind, können sie über die ästhetische Wirkung etwas verraten. Hebbel nimmt auf die positive Gestalt der Teilnahmegefühle keine besondere Rücksicht. Darum wird er herb und abstoßend genannt. Um so reineres ästhetisches Wertgefühl entzündet sich an seinen Werken.
Grundbedingung für das Zustandekommen einer ästhetischen Wirkung ist die aufmerksame Versenkung in den Gegenstand. Was unsere Aufmerksamkeit nicht zu fesseln vermag, kann uns auch nicht ästhetisch berühren. Von den mannigfachen inneren und äußeren Bedingungen der Aufmerksamkeit kommen nur solche in Betracht, die geeignet sind, sie einem Gegenstande dauernd treu zu erhalten. Die äußeren Bedingungen (wie Intensität des Reizes, Adaptation des Sinnesorgans) reichen nicht aus, um dem qualitativen Bestand des ästhetischen Gegenstandes die Eindringlichkeit zu sichern. Von den inneren Bedingungen ist die wichtigste bewußte oder unbewußte Prädisposition. Die Absicht kann die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt lenken, wie es z. B. bei Versuchen mit einfachen Figuren unerläßlich ist, da sie sonst nur geringes Interesse gewähren würden. Sonst fesselt uns, was eine Beziehung zu unserem Geistesleben hat. Eigenart und Mannigfaltigkeit, eine gewisse Neuheit muß dem Gegenstande zukommen, wenn er unsere Auf-
merksamkeit dauernd für sich gewinnen soll. Eigenartige Technik (wie etwa die Segantinis), ein neues Prinzip der musikalischen Entwicklung (wie bei Richard Wagner), die reichgegliederte Fassade eines Renaissancebauwerks, eine Fülle von Charakteren und Situationen (wie bei Shakespeare), sie erregen eindringliche Stimmungen und Gedanken, einen unvergeßlichen Aufruhr der Seele. Klassisch nennen wir das Kunstwerk, das in diesem Sinne allerorten und allerzeit fesselt. Hier enthüllt sich anregender Reichtum, unentdeckte Tiefe. Hier werden die Gegenstände geformt, die uns immer wieder zu Herzen sprechen, weil sie wie Glück, Liebe, Kampf unser Menschenschicksal stets bestimmen. Goethes Faust, Beethovens neunte Symphonie, Michelangelos Jüngstes Gericht, – ihre Schöpfer besaßen das Geheimnis des ewig Jungen und Wirksamen.
Gefallen und Mißfallen sind echte Gefühle der Lust und Unlust. Daß sie sich innerhalb engerer Grenzen der Intensität bewegen, daß sie zu den praktischen Aufgaben des Lebens keine Beziehung haben, daß sie Erkenntnis weder fördern noch voraussetzen, daß sie weder aus Trieben entspringen noch Begierden entfesseln, all das rechtfertigt doch nicht, sie als scheinhafte Gefühle aufzufassen.
Mit dem Worte vom ästhetischen Genuß hat man wie Groos das ganze rezeptive Verhalten überhaupt bezeichnet. Man kann aber auch damit nur die Gemütserregungen im ästhetischen Zustand, insbesondere die Lust am Objekt bezeichnen. In diesem Sinne hat M. Geiger in Husserls Jahrbuch für Philosophie (1913, Bd. 1) die Phänomene genauer analysiert. Alle seine Bestimmungen fügen sich unserer Auffassung gut ein und ergänzen sie. Geiger rechnet den Genuß zu den Lusterlebnissen, sucht jedoch die spezifische Qualität festzustellen, durch die er sich von anderen unterscheidet. Der Genuß ist motivlos, ohne Zweck und Absicht sich selbst genug. Sein Objekt muß vergegenwärtigt, für das Bewußtsein gegeben sein, es muß eine gewisse Fülle haben und in diesem Sinne anschaulich sein. Kein Willens-
moment spielt in die ästhetische Freude hinein, kein Urteil einer Anerkennung oder Verwerfung. Der Genuß ist ein Erlebnis mit Ichbeteiligung und Hingabe; Aufnahme, lchzentrierung liegen darin. Er ist tief, sofern er auf das zentrale Ich bezogen ist, das Ich vollkommen erfüllt; es gibt Grade seiner Tiefe, so kann er ernst oder leicht sein. Ästhetischer Genuß und ästhetischer Wert fallen nicht zusammen. Jener kann auch dort stattfinden, wo keine Werte vorliegen, wie bei eigenen Stimmungen. Aller ästhetische Genuß ist Betrachtungsgenuß. Die Konzentration nach außen ist für ihn wesentlich, eine gewisse Fernhaltung von Ich und Genußobjekt. Begierdeloses Betrachten ist ein Wahrzeichen für den ästhetischen Genuß.
Nicht jeder, der ästhetisch genießt, braucht das Resultat seiner Auffassung in bewertenden Urteilen auszudrücken. Aber jedes von der eigenen Meinung abweichende Urteil veranlaßt meist eine, wenn auch noch so unvollkommene Prüfung, und das Mitteilungsbedürfnis pflegt, ebenso wie der Wunsch, sich selbst abschließende Rechenschaft zu geben, zur ästhetischen Beurteilung zu treiben. Zum vollständigen ästhetischen Verhalten gehört also Prüfung und wertende Beurteilung. Man darf nicht meinen, daß Prüfung und Beurteilung notwendig zuletzt sich einstellen müßten, nachdem die anderen Stadien des ästhetischen Verhaltens bereits durchlaufen wären. Alle Stadien durchdringen sich; dennoch setzen Prüfung und Beurteilung die verständnisvolle Einfühlung ebenso voraus wie das emotionale Erlebnis des Gefallens oder Mißfallens.
Die ästhetische Prüfung sucht das Geschmacksurteil zu begründen; eine solche Prüfung setzt Wertmaßstäbe voraus, wenn sie nicht willkürlich oder zufällig bleiben soll. A priori finden wir solche nicht, und wir können sie auch nicht durch einfache Analyse ableiten. Cohn stellt durch Analyse des Geschmacksurteils fest, daß sein Gegenstand anschaulicher
Eigenwert sei und daß der behauptete Wert Forderungscharakter habe. Aber daraus ergeben sich keine Maßstäbe für bestimmte Wertungen. Derartige Maßstäbe sind in der aktuellen und potenziellen ästhetischen Wirkung gegeben. Ich kann mich bei der Prüfung darauf berufen, daß etwas tatsächlich gefällt oder mißfällt. Oder ich kann mich darauf berufen, daß ästhetische Wertungen früher in einem gewissen Sinne stattgefunden haben: Bilder solcher Art haben mir immer gefallen. Endlich aber kann ich bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien anerkennen und wissen, daß sie in diesem Falle anwendbar sind. Die Kenntnis solcher Gesetze kann eine rein empirisch zufällige oder eine wissenschaftlich erworbene sein. Von Normen aber, die schlechthin vorschreiben „das soll und muß gefallen“ ist dabei keine Rede. Letzte Quelle aller Maßstäbe auf diesem Gebiet ist und bleibt vielmehr das wirkliche Gefallen und Mißfallen, wenn es nur aus dem reinen ästhetischen Verhalten entspringt.
Die ästhetische Prüfung kann mehr oder weniger vollständig sein. Dem Ideal ästhetischen Verhaltens entspricht eindringende Bewertung des Gegenstands, der Fülle dessen, was sich verständnisvoller Auffassung erschließt, des Eindrucks, der Teilnahme, die er weckt, der Freude, die er spendet. Eine absolute Berechtigung, so und nicht anders zu urteilen, kann niemals das Ergebnis solcher Prüfung sein. Doch kann das ästhetische Urteil soweit begründet werden, daß es sich als berechtigt würdigen läßt. Daß eine auf diese Weise ausgeführte Prüfung immer nur relativ und hypothetisch gültige Urteile erlaubt, ist zweifellos. Man kann daher nur sagen, daß, nach unserer Kenntnis ästhetischer Wirkungen, für unser ästhetisches Verhalten dieser Gegenstand einen gewissen Wert hat. Mehr kann man weder verlangen noch erreichen. Damit ist immerhin die Möglichkeit einer Verständigung in Sachen des Geschmacks, einer Mitteilung der eignen Auffassung, einer Verteidigung von künstlerischen Absichten und Werken gewährleistet. Wertungs-
unterschiede sind ja tatsächlich immer in Fülle gegeben, aber wir brauchen nicht jedes Geschmacksurteil zu rechtfertigen, sondern nur diejenigen, die unter der Herrschaft des ästhetischen Verhaltens zustandegekommen sind. Innerhalb dieses Gebietes aber haben wir kein Recht, das eine Urteil für beachtenswerter zu halten als das andere. Deshalb ist Spielraum für individuelle Neigungen reichlich frei. Die einzelnen Wertbeziehungen können verschieden stark betont werden, damit ändert sich auch das Ergebnis der ästhetischen Prüfung. Auf verschiedene gleichwertige Stilarten werden sich die Neigungen der Kunstfreunde verteilen. Der eine zieht die Böcklinschen Farbenharmonien vor, der andere Lionardos sfumato, ein dritter Feuerbachs große Linie, ohne daß er seine Liebhaberei einem Bewunderer Rembrandtschen Helldunkels aufdringen will. Diese Einsicht wird eher der Verständigung als weiterem Zwiespalt dienen.
Dazu kann ferner eine Einteilung der ästhetischen Urteile helfen, welche deren Hauptarten hervorhebt, ohne erschöpfen zu wollen. Es empfiehlt sich vier Klassen zu unterscheiden: Verständnisurteile, Eindrucksurteile, Geschmacksurteile und Werturteile. Jeder kompliziertere ästhetische Eindruck setzt für die Entfaltung seiner vollen und ungehemmten Wirkung ein Eindringen in seinen sinnvoll zusammenhängenden Aufbau voraus. Man denke an die Kommentare zum Faust, zum Hamlet, zur Divina Commedia, die solches Suchen nach tieferem Verständnis entfesselt hat. Es sind die Verständnisurteile, welche die Bedeutung des ästhetischen Gegenstandes klären. Freilich ist das Verständnis noch kein vollentfaltetes ästhetisches Verhalten, sondern nur Vorbedingung der ästhetischen Wirkung. Ohne Verständnis gibt es nur unzureichende Teilnahme, keine Geschlossenheit des Eindrucks, keine Einordnung von Einzelheiten in Geist und Leben des Kunstwerks. Solche Urteile des Verständnisses brauchen nicht immer durch förmliche Sätze repräsentiert zu sein. Nicht nur die Kontemplation, auch die einfache Einfühlung findet ihren Ausdruck in Verständnisurteilen.
Die Eindrucksurteile geben die Wirkung wieder, die das ästhetische Objekt in seinem Zusammentreffen mit unserem ästhetischen Zustande in uns hervorruft; sie verlautbaren das Miterleben und die Teilnahme. Dies rührt mich, stößt mich ab, wirkt furchtbar, erhebt mich. Während die Verständnisurteile ein objektives Gepräge tragen, bezeichnen die Eindrucksurteile die ausgelösten subjektiven Zustände. Es ist vor allem der ästhetische Genuß, der sich in Eindrucks urteilen mitteilen läßt.
Das ästhetische Urteil im engeren Sinne nennt man Geschmacksurteil. Es sagt Gefallen oder Mißfallen aus. Vermöge der naiv-realistischen Prädizierung der Geschmacksqualitäten wird dabei der ästhetische Gegenstand selbst schön, anmutig, komisch genannt, wie man auch sagt; ein schmerzhafter Stich, eine drückende Last. Man kann hier zum Unterschiede von Lockes sekundären Qualitäten versucht sein, von tertiären Qualitäten zu sprechen. Die Prädizierungen des Geschmacksurteils können ästhetische Wirkungsaktualität ausdrücken, wirkliches Gefallen; dann ist das ästhetische Urteil assertorisch. Man kann sich auch mit der Aussage über ein mögliches Gefallen, über ästhetische Wirkungspotenzialität begnügen; dann ist das Geschmacksurteil problematisch. Apodiktisch kann das Geschmacksurteil als solches nie werden. Wer im Überschwang der Begeisterung für eine ihm unerhörte Schönheit Empfänglichkeit erzwingen will, wird, durch trübe Erfahrungen auch an höchst feinsinnigen Kunstfreunden enttäuscht, seine Hoffnungen dämpfen müssen. Das Geschmacksurteil ist also Aussage von wirklichen oder möglichen Wertgefühlen. Seine Geltung ist offenbar sehr verschieden, je nachdem man urteilt „dies Werk gefällt“ oder nur „es kann gefallen“. Unter diesen Voraussetzungen sind auch gegensätzliche Geschmacksurteile über den gleichen Gegenstand möglich. Was dem einen gefällt, mißfällt dem anderen; und der eine kann mit Recht behaupten, daß dem Objekt die Fähigkeit zu gefallen zukomme, während der andere mit gleichem Rechte aussagt, daß es mißfallen könne.
Darin liegt nur für den eine Schwierigkeit, der in jedem positiven Geschmacksurteil bereits ein ästhetisches Gesetz wittert. Alle Gefühlsurteile, die schlechthin eine wirkliche oder mögliche Regung aussagen, sind mit solchen individuellen Verschiedenheiten behaftet. Ist ästhetisches Gefallen möglich, so hängt sein Eintreten offensichtlich von besonderen Umständen und Bedingungen ab; fällen zwei Personen über denselben Gegenstand verschiedene Geschmacksurteile, so können die besonderen Bedingungen nur im urteilenden Subjekt gesucht werden. Sucht man diese Unterschiede aus dem Verhalten und Befinden der Subjekte zu erklären, so erledigt sich jede Schwierigkeit. Es hängt von notwendigen und von zufälligen Eigentümlichkeiten eines Jeden ab, wie sein Geschmacksurteil im einzelnen Falle lautet. Die zufälligen Besonderheiten lassen sich gar nicht erschöpfen, man denke nur an Stimmung, Erwartung und Frische. Die notwendigen Eigentümlichkeiten machen sein ästhetisches Verhalten aus. Selbstverständlich ist mit der Hervorhebung dieser subjektiven Unterschiede nicht gesagt, nur das ästhetische Objekt trage überall in gleicher Weise zum Gefallen oder Mißfallen bei. Es findet sich ja auch genug Übereinstimmung in Geschmacksurteilen, und es gibt Hilfsmittel, sich von den zufälligen Eigentümlichkeiten freizumachen. Ja, es ist gerade eine Hauptaufgabe der Ästhetik, die Beschaffenheit gefallender und mißfallender Gegenstände unter Voraussetzung eines idealen ästhetischen Verhaltens zu charakterisieren. Um die Geschmacksunterschiede zu erklären, bleibt immer die Mannigfaltigkeit einzelner subjektiver Bedingungen und die komplexe Zusammenfügung des ästhetischen Objekts. Der Satz de gustibus non est disputandum ist richtig, soweit er auf die verschiedenen Voraussetzungen der Urteilenden hinweist, welche die Verschiedenheit ihrer Urteile bedingen und jedes Urteil als gültig erscheinen lassen können. Er ist unrichtig, wenn er den Gedanken nahelegt, als ließe sich über diese Voraussetzungen durchaus nichts bestimmen und als wäre demnach eine Verständigung über
die Gründe der Abweichung unmöglich. Eine vollendete Ästhetik könnte allgemeingültig sein, ohne daß die Geschmacksurteile es wären. Das ist die wahre Auflösung von Kants ästhetischer Antinomie.
Die letzte Klasse der ästhetischen Urteile umfaßt die eigentlichen, im engsten Sinne sogenannten Werturteile; sie prädizieren den ästhetischen Wert oder Unwert eines Objekts auf Grund der für seine Wirkung maßgebenden Abhängigkeiten. Sie erheben Anspruch auf objektive und allgemeine Geltung, weil sie auf einer umfassenden kritischen Prüfung aller im ästhetischen Objekt enthaltenen Wertbedingungen beruhen. Hier wird von individuellen Unterschieden abgesehen und lediglich der ästhetische Eindruck gewürdigt, wobei ein gleichartiges ideales zuständliches Verhalten vorausgesetzt wird. Darüber, ob diese Bedingung überall zutrifft, wird nichts ausgesagt; es wird nur behauptet, daß wenn sie erfüllt ist, das Werturteil auf einer notwendigen ästhetischen Wirkung beruht. An unausgleichbaren individuellen Differenzen scheitert schließlich immer wieder der Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit auch für alle praktisch vollzogenen Werturteile. Dennoch müssen sie von den Geschmacksurteilen, in denen ungeprüft die schlichte Reaktion auf den ästhetischen Gegenstand zum Ausdruck kommt, wohl unterschieden werden. Das Werturteil sucht die Werteigenschaften des ästhetischen Objekts zu erschöpfen und nutzt dazu alle verfügbaren Maßstäbe: den eigenen gegenwärtigen Eindruck, die Erfahrung über Urteile der Kulturmenschheit; vor allem aber beruft es sich auf die Gesetze und Prinzipien der ästhetischen Wirkung. Da diese nach unserer Ansicht nicht a priori zu begründen sind, da sie keiner metaphysischen, biologischen oder ethischen Normierung entnommen werden können, so bleiben die Geschmacksurteile aus idealästhetischem Verhalten die letzte Grundlage. Die ihnen anhaftenden, auf abweichender ästhetischer Empfänglichkeit beruhenden individuellen Unterschiede können daher auch aus den Werturteilen nicht eliminiert werden. Man
kann also immer nur von deren relativer Wahrheit und Richtigkeit sprechen. In Übereinstimmung damit zeigt die Geschichte ein beständiges Schwanken der ästhetischen Urteile.
Die unausgleichbaren individuellen Unterschiede in der ästhetischen Empfänglichkeit prägen sich in allen Phasen des ästhetischen Verhaltens aus. Unausgleichbar sind die Unterschiede in der Kontemplation, in der geistigen Aneignung des ästhetischen Objekts. Differenzen in der sinnlichen Disposition wiegen hier ebenso schwer, wie Abweichungen in der intellektuellen Gestaltung des sinnlichen Materials. Farbentüchtige Personen genießen leicht ganze Stilarten der Malerei, für die Farbenuntüchtigen fast jede Voraussetzung mangelt; die Fähigkeit der Gestaltwahrnehmung disponiert für die Auffassung zeichnerischer Formgebung, wie das feine Gehör für edlere Musik. Ob Vorstellungsbilder lebhaft oder matt sind, ist ausschlaggebend für die Freude an dichterischer Landschaftsschilderung. Zu den Unterschieden zwischen anschaulicher und unanschaulicher Repräsentation des Gegenstandes treten solche in der Leichtigkeit des Verständnisses. Auch bestehen tiefgreifende Differenzen in der Fähigkeit zu einfühlender Bereicherung. Nüchterne, kühle, indifferente Naturen werden weniger leicht, sicher und lebhaft einfühlen, als phantasievolle, erregbare und romantische Menschen. Man kann zur einfachen Einfühlung anders prädisponiert sein als zum sympathischen Miterleben. Die weite Einfühlungsgabe der Künstler wird auch durch ethische Mißbilligung nicht gelähmt werden. Ebenso zahlreiche individuelle Differenzen bestehen zwischen den zuständlichen Gemütsbewegungen. Die Teilnahme hat ihre Grade, Wertgefühle des Gefallens und Mißfallens werden mit sehr abgestufter Lebhaftigkeit erregt. Auch die Fähigkeit zur Prüfung kann gering oder groß sein. Es gibt ästhetische Kritiker ohne inneren Beruf zu dieser Leistung. Disposition zu Wertgefühlen und ästhetischer Beurteilung pflegt man als Geschmack zu be-
zeichnen. Grob nennen wir einen Geschmack, wenn das Wertgefühl nur von starken Reizen der Sensation erregt wird, der stoffliche Inhalt als solcher fesselt. Der ungebildete Geschmack verlangt spannende Szenen. Der Vorliebe für unmittelbare ästhetische Wirkung, satte Farben, symmetrische Raumwirkung, wohllautende Tonfolgen steht eine besondere Schätzung von Ideen und mittelbaren ästhetischen Wirkungen gegenüber, eine Neigung zu läuternder und ergreifender Darstellung tiefsinniger Werke. Es gibt Menschen, die überall den ästhetischen Gesichtspunkt herausfinden, denen kaum ein Ding ästhetisch gleichgültig ist; Ästheten sind es, die ihr ganzes Leben nach ästhetischen Gesichtspunkten regeln. Die Künstler sind meist nicht Ästheten. Im Gegensatz dazu bleiben andere ästhetisch träge, stumpf und ungerührt bei den erhabensten und schönsten Eindrücken. Es sind Anästheten, amusische Menschen. Zwischen diesen Extremen gibt es alle Abstufungen der ästhetischen Erregbarkeit. Das ästhetische Verhalten kann nicht erzwungen werden. Gewiß gibt es ästhetische Durchbildung, aber nur sanfte Hände können sie leiten. Das ästhetische Verhalten gehört zu den stolzen Vorzügen menschlicher Freiheit; dafür ist es auch allem Mißbrauch der Freiheit ausgesetzt; es kann verkümmern, bizarr werden, entarten. Aber mit der Entfaltung der Persönlichkeit kann auch das Interesse reger, die Kontemplation versunkener, die Einfühlung lebendiger und vielseitiger werden. Jedenfalls gedeihen Kunst und Kunstgenuß nur in der individuellen Freiheit; sie spotten aller Bindung durch Vorschriften und aller Preisrichter. Es gibt keinen ästhetischen Areopag, und keine normative Fessel schnürt den großen Künstler wirksam ein. Wie schon Kant es ausspricht, geben nur die genialen Vorbilder aller Kunst Maß und Richtung.
Phantasie und Gestaltungskraft regen sich ursprünglich triebartig in der schöpferischen Produktion ästhetischer Ob-
jekte. Die Werke de Genies verdanken seinen Talenten Eigenart und Reichtum der Erfindung, Vollkommenheit der Darstellung, originalen ästhetischen Wert. Was wir bisher als Einstellung, Einfühlung, Empfänglichkeit, Prüfen und Werten, Gefallen und Mißfallen dargetan haben, ist auch im produktiven ästhetischen Verhalten wiederzufinden. In allen Schilderungen genialen Schaffens kehren diese Züge zweifellos wieder. Der große Künstler ist ein Mensch gesteigerter Empfänglichkeit, von feinen Sinnen, außergewöhnlichem Gedächtnis, voll Lebhaftigkeit und Treue der Erinnerungsbilder. Seine Phantasiegestalten sind wunderbar gegenständlich, seine Neigung zur Kontemplation ist lebenbestimmend, groß ist die Gewalt seiner Einfühlung, außerordentlich seine Sorgfalt, unermüdlich seine Geduld. Nur die umfassendsten Genien vereinen mehrere Talente; es sind dann Universalgenies. Am einseitigsten pflegt sich die musikalische Begabung auszuprägen. Zum genialen Werke wirken ineinander ein inneres Wachsen und die äußere (technische) Darstellung. Die schaffende Phantasie waltet mit den Darstellungsmitteln (Farben, Marmor) nicht ungebunden. Als Leistung der Phantasie bezeichnet die Gewohnheit die Erfindung neuer Einfälle. Doch bewährt sich die Phantasie nicht etwa eigenwertig in der Ersinnung wunderlicher Seltsamkeiten. Die künstlerische Eigenart wird durch Vorbilder aus Natur und Menschenwelt nicht geschmälert. Auch die naturalistische Formel vom Stück Natur, gesehen durch ein Temperament, läßt genialer Auffassung und Aneignung Spielraum genug.
Nach Ribot gehören zum Erfinden aus schöpferischer Phantasie drei Faktoren, ein intellektueller, ein affektiver und ein unbewußter. Der intellektuelle Faktor umfaßt die Einfälle an Bildern, an Gedanken und deren Verbindungen, der affektive drängt als Verlangen nach Darstellung, Einfühlung, Miterleben. Den unbewußten Faktor nennt man Inspiration. Man weiß nicht, woher sie kommt. Plötzlich, ungerufen und ungezwungen steht ein Motiv, ein Bild vor der Seele. Fremd,
zugerufen, nicht selbstgeschaffen wirkt ein solches Gebilde. Ähnliches widerfährt auch dem wissenschaftlichen, technischen, politischen Erfinder. Dem ästhetischen Wollen mangelt Zweck und Ziel zum Unterschied vom sittlichen Wollen. Dieser Spieltrieb entwickelt sich bei Künstlern früh mit selbstverständlicher Kraft und Fülle, oft angeregt durch geringfügigen Anlaß, ein unscheinbares Landschaftsbild, einen seltenen Naturlaut. All dies gewaltige Aufgebot an künstlerischer Phantasie bleibt ohnmächtig ohne künstlerische Hand und Handwerk; aber auch die unentbehrliche Handfertigkeit ist zum besten Teil Wiegengeschenk der Natur. Der Künstler komponiert und phantasiert noch in seinem Stoffe. Die Schöpfung vollendet sich in Entwürfen und über der Ausführung. Je nach der Begabung und dem Sondertalent sind Erfindung und Darstellung an der Entstehung des Kunstwerks beteiligt. Von Virtuosität spricht man bei Mangel an erfinderischen Einfällen, bei bloßer Beherrschung der technischen Mittel, von fehlender Gestaltungsgabe, wo die Ausführung versagt, ohne daß der Strom der Erfindung versiegte. Der Anlaß zu beginnender Darstellung und zur Inspiration erscheint bei alledem nur bedeutungslos und zufällig, wenn man vergißt, wie lange Zeit vorher die Einfälle bereits vorbereitet sein können. Häufig entstammt die Inspiration einer Anregung, deren Wirkung nicht unmittelbar bewußt geworden ist. Wiederum liegt einer Stoffwahl, für die ein Meister sich prüfend und wohlüberlegt entscheidet, eine Vorgeschichte zugrunde, die sich nicht selten ins Dunkel des Künstlerlebens verliert. Aus tiefgehenden Konflikten, überraschenden Erlebnissen, erschütternden Szenen erwächst in schöpferischem Prozeß schließlich die Gelegenheit zur Dichtung, von der Goethe sagt.
Wichtig ist Ribots Hinweis auf die Dissoziationen im produktiven ästhetischen Verhalten, auf jenes Zerfallen sonst festgeketteter Assoziationsbindung, auf die Fülle neuer Inhaltskonstellationen unter dem Einfluß des ästhetischen Zustandes. Darüber darf die strenge und bewußte Kontrolle
nicht vergessen werden, die unter der übergroßen Menge der neugestalteten Einfälle wählt, behält, verwirft. Hier wirken technische Kenntnisse, Übungen und trübe Erfahrungen mit, leitende und beschränkende konstante Tendenzen, die den Bildungsprozeß in allen Phasen nicht immer bewußt begleiten, aber stets unmerklich beeinflussen. Darum arbeiten die bedeutenden Künstler mit so unerbittlicher Sorgfalt, bessern und feilen, sichten und suchen, bis ihnen das Werk ein niemals völliges Genüge tut. Das Werk drängt immer zur vollendeten Darstellung. Den Maler befriedigt die Skizze so wenig, wie den Architekten die Risse zu seinem Bauwerk. Der Komponist verlangt die beste Aufführung, der dramatische Dichter Bühnenauswirkung seiner Schöpfung.
Man hat in letzter Vergangenheit sich viel Mühe gegeben, das Genie als pathologisch hinzustellen, es mit Wahnsinn und Verbrechen in einem Atem zu nennen. Man setzt dazu voraus, daß alles, was vom Durchschnitt abweicht, deshalb schon krankhaft ist. Man überspannt den Vergleich zwischen psychophysischen Organisationen, die einige ähnliche Züge aufweisen, wie übrigens Wahnbilder und Traumbilder auch tun, ohne daß der Träumer darum irrsinnig ist. Zur Krankheit gehört eine Schädigung des Organismus. Mit dem rohen Nachweis einiger Degenerationsmerkmale ist noch nichts geleistet. Die lebhafte Einbildungskraft teilt freilich das Genie mit dem Wahnsinnigen, aber eben auch mit Träumern und Hypnotisierten. Durch die gesunde Urteilskraft unterscheidet sich das Genie vom Irrsinn auf das Bestimmteste. Wenn das Genie in seinen Bildern lebt wie in der Wirklichkeit, so ist das für jede ästhetische Versunkenheit bezeichnend. Ein Kind in voller Bühnenillusion ist nicht krank. Niemand zweifelt daran, daß die reiche Seele des genialen Menschen in einem verfeinerten Leibe wohnt; wer sich in diesen Gedanken vertieft, wird bald darauf verzichten, die somatischen Grundlagen seiner Begabung in Schädelformen und Ohrmuschelbildungen aufzuspüren.
Literatur.
Vaihinger, Die Philosophie des Als-Ob. Berlin 1911.
Lichtwark, Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken. 7.
Aufl. Berlin
1909.
R. Vischer, Über das optische Formgefühl. Leipzig.
1873.
Groos, Der ästhetische Genuß. Gießen
1902.
Volkelt, Der Symbolbegriff in der neuesten Ästhetik. Jena 1876.
Stern, Einfühlung und Assoziation in der neuesten
Ästhetik. Lipps’ und
Werners Beiträge zur Ästhetik, Hamburg 1898.
Geiger, Zum Problem der Stimmungseinfühlung. Zeitschrift
für
Ästhetik, 1911, Bd. 6.
— Beiträge
zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses.
Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische
Forschung, 1913, Bd. 1.
— Bericht über den IV. Kongreß
für experimentelle
Psychologie. Innsbruck 1910.
Th. Meyer, Kritik der Einfühlungstheorie. Zeitschrift
für
Ästhetik, Bd. 7, S. 529.
Schultze, Wirkungsakzente ... Archiv für die ges. Psychologie,
1906, Bd.
8, S. 339.
Ritook, Zur Analyse der ästhetischen Wirkung. Zeitschrift
für
Ästhetik, Bd. 5, S. 365.
Bullough, The „perceptive problem“ in the aesthetic
appreciation of single colours. British Journal of Psychology, 1908,
Bd. 2.
Landmann-Kalischer, Analyse der ästhetischen Kontemplation.
Zeitschrift
für Psychologie, 1902, Bd. 28.
— Über den Erkenntniswert ästhetischer
Urteile. Archiv für
die ges. Psychologie, 1903, Bd. 5.
Siebeck, Das Wesen der ästhetischen Anschauung. Berlin 1875.
Dilthey, Dichterische Einbildungskraft und Wahnsinn. Rede. 1886.
— Das Erlebnis und die Dichtung. 3. Aufl. Leipzig 1910.
Brentano, Das Genie. Vortrag. 1892.
Türck, Der geniale Mensch. 6. Aufl. Berlin 1903.
Séailles, Essai sur le génie
dans l’art. 2. éd. Paris 1897.
Ribot, L’imagination créatrice. Deutsche Ausgabe.
Bonn 1902.
(Die
Schöpferkraft der Phantasie.)
Löwenfeld, Über die geniale
Geistestätigkeit. Wiesbaden
1903.
Popp, Maler-Ästhetik. Straßburg 1902.
Müller-Freienfels, Zur Analyse der schöpferischen
Phantasie.
Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. Philosophie, 1909.
Dohrn, Die künstlerische Darstellung als Problem der
Ästhetik. Lipps’ und Werners Beiträge zur
Ästhetik, 1908, Bd. 10.
Innerhalb der Grenzen sinnlicher Gleichwertigkeiten scheinen Einzelqualitäten keinen allgemeingültigen Vorzug voreinander zu haben. Bei Kombinationen materialer Elemente ist der anschauliche Zusammenhang trotz größerer Verschiedenheit wesentliche Bedingung einer positiven ästhetischen Wirkung. Keine einzige Empfindungsqualität als solche ist von der ästhetischen Wirkung ausgeschlossen. Wo die einzelnen Qualitäten in ihrer Eigenart die Aufmerksamkeit fesseln, wirken auch Farben, Töne, Gerüche als solche schon ästhetisch. Nach Preyers Forschungen über die Seele des Kindes (1895, 4. Aufl.) erregen mäßig helle Lichteindrücke, langsam vor den Augen bewegte Objekte, allerlei Klänge, süße Düfte schon im ersten Vierteljahr des Lebens eine vielleicht nicht lediglich sinnliche Lust. Welche Qualitäten ästhetische Lust, welche Unlust erregen, ist noch nicht allgemeingültig anzugeben. Hier gibt es schon größere individuelle Unterschiede. Bei den Farben ziehen einige Personen die warmen Farben (rot – gelb) vor, andere die kalten (blau – violett). Alle Versuchspersonen Cohns hatten eine Abneigung gegen Gelb, die bei Major und Baker durchaus nicht hervortrat. Bei Cohn wurden meist die gesättigten Farben vorgezogen, bei Major nicht allgemein. Auch mit der Helligkeitsreihe verhält es sich ähnlich. Einige ziehen die hellen, andere die dunkeln Farben vor. Bei Tönen ist es ebenso. Geräusche als solche pflegen gleichgültig zu lassen oder zu mißfallen. Auf dem Gebiet der niederen Sinne sind die individuellen Unterschiede geringer. Bei Tasteindrücken
wird mit großer Konstanz das Glatte, Weiche und Stumpfe dem Rauhen, Harten und Spitzen vorgezogen. Einzelne Stimmgabelklänge konnten nach Kaestner meist nicht als angenehmer oder unangenehmer bezeichnet werden. Man kann also überhaupt zweifelhaft sein, ob einer einzelnen Qualität als solcher unmittelbare ästhetische Wirkung zukommt, die zu individuellen Differenzen weiterführt. Wie stark dagegen mittelbare Wirkungen schon bei einzelnen Qualitäten eingreifen können, sieht man aus der Untersuchung von Geiger (Zeitschr. f. Ästh., Bd. 6). Dort heißen Farben: dünn, arm, gemein, dumm, feurig, fröhlich, reizend, lieblich, kalt. Der Charakter der Farbe erscheint als die höchste Form ihrer ästhetischen Wirkung, als objektive und beständige Vergegenständlichung einer Stimmung. Davon verschieden sind die losen und verschmolzenen assoziativen Einschläge, wie die Erinnerung an ein Gemälde oder Eindrücke wie goldbraun, silberhell, kupferrot.
Über die Verbindungen von Qualitäten liegen wenig gesicherte Erfahrungen vor. Bei Farbenkombinationen fand Cohn, daß die Komplementärfarben anderen Zusammenstellungen vorgezogen werden. Baker hat die Untersuchungen von Cohn durchgeprüft und bei einer größeren Zahl von Elementen gefunden, daß die wohlgefälligsten Kombinationen nicht zwischen den Komplementärfarben, sondern zwischen Farben geringeren Qualitätsunterschieds bestehen, wenn gleiche Sättigung für alle Farben gewählt wird. Absolut gefällige Farbenkombinationen gibt es überhaupt nicht, sondern nur gefällige Zusammenstellungen für Farben bestimmter Qualität, Helligkeit, Sättigung und Raumbeschaffenheit. Bei genauerer Prüfung: der Bakerschen Tabellen kann Cohn nicht aJs widerlegt gelten. Warum Komplementärfarben bei binärer Zusammenstellung bevorzugt werden, hat die Ästhetiker schon oft beschäftigt und zu sehr verschiedenen Ansichten geführt. Es liegt nahe, auch des Einflusses zu gedenken, den Zusammenstellungen kontrastierender Farben auf die Erfassung der Objekte ausüben. Die Umrisse der Gegenstände
im Raume heben sich schärfer voneinander ab, wenn ihre Farben kontrastieren. Überdies heben sich komplementäre Farben. Bei Kombinationen von mehr als zwei Elementen werden die komplementären aufeinanderbezogen, zusammengefaßt. Wenn wir auch von der Einfühlung und sonstiger mittelbarer ästhetischer Wirkung absehen, so finden wir für Farbenkombinationen als Bedingung ästhetischen Eindrucks mannigfaltige Fülle, übersichtliche Einheit des Gesamteindrucks. Die raumbeherrschende, motivisch wiederkehrende, alle anderen ihrer Umgebung hebende Farbe getönter Flächen heißt deren Grundton. Der Eindruck der Farbenkombination übertäubt fast völlig das individuelle Gefallen oder Mißfallen an der Einzelfarbe. Eine Ausnahme bilden nur Farben, die sich nicht mit anderen verbinden, aus einem Gemälde herausfallen. Den vollen Stimmungsgehalt verdanken aber auch Farbenkombinationen erst der Einfühlung. Der Reichtum an Stimmung schenkt der Farbenmannigfaltigkeit ihre Fülle, der Stimmungszusammenklang herrscht mit im anschaulichen Zusammenhang.
Bei einfachen Raumverhältnissen wird scheinbare Gleichheit der Strecken bevorzugt, dann einfache Verhältnisse, besonders der goldene Schnitt, darüber hinaus merkliche Regelmäßigkeit der übersichtlichen Anordnung. Zu geringe Größe erschwert die Auffassung der Einzelheiten, zu gewaltige Ausdehnung stört den Aufbau eines Gesamteindrucks. Weit entscheidender für die ästhetische Raum-, Flächen- und Linienwirkung sind die Verhältnisse der Entfernungen. Nach den Versuchen von Witmer weicht das gefälligste Verhältnis zweier Linien vom goldenen Schnitt ein wenig ab (1: 1,706 statt 1: 1,618), bei Rechtecken war die Annäherung an den goldenen Schnitt am größten, bei Ellipsen wich das Verhältnis der Achsen etwas nach 2: 3 hin ab (1: 1,527). Bei mehr als zwei Vergleichsgrößen treten die einfachen Verhältnisse (1 : 2: 3: 4) als wohlgefällig hervor. Über elementare ästhetische Wirkungen der Zeitverhältnisse sind wir fast ganz ohne exakte Kunde. Bolton (Americ.
Journ. of Psych., Bd. 6) fand, daß elementare Rhythmen bei einer Gesamtdauer von etwa 1,25 Sekunden für ein Gebilde am wohlgefälligsten wirken. Je nach der Anzahl der Glieder ist demnach die Geschwindigkeit kleiner oder größer. Ein viergliedriger Rhythmus mit der Dauer von 1,2 Sekunden scheint am meisten den Bedingungen der ästhetischen Auffassung zu genügen, soweit der direkte Faktor allein in Frage kommt.
Weit mehr wissen wir von den elementaren ästhetischen Wirkungen in der Musik; weshalb wir auf sie auch breiter eingehen. Kaestner (Wundts Psychol. Stud., Bd. 4) fand ein Annehmlichkeitsmaximum bei der großen Terz. Schwebungen bedingen Unannehmlichkeit. Die kleine Sekunde erschien als das unangenehmste Intervall. Das Intervall 256:284, von Stumpf und Krueger als Unlustmaximum bezeichnet, wird in den wenigen Reihen, in denen es bei Kaestner vorkommt, nicht einheitlich als unangenehmstes gewertet. Der erregende Charakter wird hier wie bei der kleinen Sekunde mehrfach betont. Das Intervall 6:7, angenehmer als Sekund und Septime, erscheint weicher, voller, harmonischer. 13:16 gehört zu den angenehmsten Zweiklängen, erscheint als Terz. Die große Terz wird voll, klar, weich, beruhigend, sympathisch, feierlich genannt. Die Quarte wirkt unangenehmer als die Terz, die Quinte heißt rein, leer, hohl, mild. Die Sexten werden beim Tonmesser günstiger beurteilt als bei Stimmgabeln. Die große und kleine Septime stehen der Sekund nahe, während die natürliche Septime 4:7 ebenso wie 9:16 angenehmer erscheint. Bei den Septimen wird einhellig das Scharfe und Erregende hervorgehoben. Die Oktave steht der Prim ziemlich nahe. Zwischen Gefühlswirkung und Schwebung besteht kein eindeutiges Abhängigkeitsverhältnis. Der Einfluß der momentanen Stimmung verändert das Urteil, indem Intervalle, die zu ihr nicht passen, unangenehm genannt werden. Sie heißen dann zu pathetisch, zu sentimental. Sonst unangenehme Intervalle wirken angenehmer, wenn sie temperamentvoll, leidenschaftlich er-
scheinen. Versuchspersonen, die der modernsten Musik zuneigen, vernachlässigen die Terzen und bevorzugen die Septimen. Soweit Kaestner.
An jedem einfachen Gehörseindruck unterscheiden wir seine Qualität, Intensität und Dauer; Ausdehnung kann ihm nicht zugeschrieben werden. Die Qualität nennen wir Tonhöhe, wonach wir den relativen Unterschied der Tiefe und Höhe bestimmen. Die Intensität bezeichnet die Musik als dynamische Bestimmung, die Dauer als „Geltung“ der Töne. In der Notenschrift wird durch Schlüssel, Vorzeichnung und Notenlage die Tonhöhe bestimmt, durch Angaben wie f., p., < und dergleichen die dynamische Intensität, durch Notenform, Striche, Punkte und dergleichen die relative Geltung, die durch Angabe eines Tempo nebst Metronombezeichnung zur absoluten werden kann.
Keine von diesen Eigenschaften hat für die Musik eine absolute Bedeutung, weder eine bestimmte Tonhöhe, noch eine bestimmte Intensität oder Dauer. Die musikalische Bedeutung der Töne wird lediglich durch ihre Umgebung, nicht durch sie selbst fixiert. Dadurch erklärt sich zunächst, daß auf die absolute Bedeutung der Tonhöhe kein Gewicht gelegt wird. Man transponiert Musikwerke; es haben nicht alle Instrumente gleiche Stimmung, die nur erforderlich wird, wenn sie zusammenwirken sollen. (Normal-a =435 und 440 Schwingungen.) Außerdem hängt damit die Tatsache zusammen, daß die Musik eine Auswahl unter den vorhandenen (oder von uns unterscheidbaren) Tönen trifft. Denn nur, wenn die relativen Tonhöhen von Wichtigkeit sind, kann eine solche Auswahl mit Bestimmtheit getroffen werden. Wir können nämlich etwa 11000 Töne bei einigermaßen geübtem Gehör unterscheiden, und innerhalb der von der Musik bevorzugten Grenzen, wo sie nur etwa 85 Töne zur Verfügung hat, können wir tatsächlich etwa 9180 Töne (also mehr als das hundertfache) unterscheiden. Wie kommt es, daß die
Musik
nur so wenige davon benutzt? Erstens läßt sich ein
allgemeingültiges Tonsystem nur dann aufbauen, wenn gleiche
Verhältnisse hergestellt werden, wenn also die musikalischen
Intervalle auf allen Stufen die gleiche Bedeutung haben. Dazu
muß eben eine Auswahl getroffen werden; denn die
Töne in der Tiefe lassen sich nicht über eine gewisse
Grenze hinaus aneinanderrücken, wenn sie noch bequem
unterschieden werden sollen. Für die kleine Sekunde C-cis
gilt
der Quotient 16/17, während er für c–cis
128/136 und für 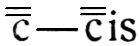 512/544
lautet. Beträgt der absolute Unterschied in den beiden
letzten Fällen etwa das 24-36fache des eben Merklichen, so
macht er im ersten Falle kaum das Doppelte und auf der
nächsten Stufe nur das Vierfache davon aus. Zweitens mangelt
weitaus den meisten Menschen das absolute Tongedächtnis,
auch wenn viele von ihnen sonst hochmusikalisch sind; die Musik
muß sich daher auf feste Intervallproportionen
gründen, für die der musikalische Mensch eben
Gehör hat. Drittens ist die menschliche Stimme nicht
fähig, feinere Unterschiede als die in der Musik
gebräuchlichen mit einiger Sicherheit hervorzubringen. (Es ist
nicht ausgeschlossen, daß hier ein Sonderfall des Weberschen
Gesetzes vorliegt.) Viertens nimmt jenseits der von der Musik
innegehaltenen Grenzen die Unterschiedsempfindlichkeit des Ohres rasch
ab. Fünftens würde unter einer Vermehrung der Zahl
der Töne der übersichtliche Aufbau der Musikwerke
leiden.
512/544
lautet. Beträgt der absolute Unterschied in den beiden
letzten Fällen etwa das 24-36fache des eben Merklichen, so
macht er im ersten Falle kaum das Doppelte und auf der
nächsten Stufe nur das Vierfache davon aus. Zweitens mangelt
weitaus den meisten Menschen das absolute Tongedächtnis,
auch wenn viele von ihnen sonst hochmusikalisch sind; die Musik
muß sich daher auf feste Intervallproportionen
gründen, für die der musikalische Mensch eben
Gehör hat. Drittens ist die menschliche Stimme nicht
fähig, feinere Unterschiede als die in der Musik
gebräuchlichen mit einiger Sicherheit hervorzubringen. (Es ist
nicht ausgeschlossen, daß hier ein Sonderfall des Weberschen
Gesetzes vorliegt.) Viertens nimmt jenseits der von der Musik
innegehaltenen Grenzen die Unterschiedsempfindlichkeit des Ohres rasch
ab. Fünftens würde unter einer Vermehrung der Zahl
der Töne der übersichtliche Aufbau der Musikwerke
leiden.
Die Einteilung in Oktaven erscheint uns insofern als die natürlichste, als Töne des Verhältnisses 1:2 einander am meisten ähneln, der höhere wie eine Wiederholung des tieferen klingt. Dann aber ist die Einrichtung einer Oktave für alle anderen maßgebend. Schon im Altertum ist daher die Oktave als Zusammenklang (als Konsonanz) geduldet worden. Übrigens ist die Tonleiter mit Unterscheidung von Halbton- und Ganztonstufen schon im Altertum (Pythagoras) ausgebildet und auf die Tetrachorde verteilt worden.
Gleiche Verhältnisse sind nun aber keineswegs gleich erscheinende Unterschiede, was man früher (E. H. Weber, Fechner) allgemein vermutet hat. Denn da innerhalb weiter Grenzen die absolute und nicht die relative Unterschiedsempfindlichkeit konstant ist, so können gleiche Verhältnisse nicht als gleiche Unterschiede erscheinen. Nicht als gleiche Unterschiede für das Gehör (vielleicht für die Stimme!) dürfen die Sekunden, Terzen usw. auf verschiedenen Stufen der Skala betrachtet werden, sondern als gleiche Verschmelzungsstufen (Konsonanzen – Dissonanzen). Damit gelangen wir bereits zu den Verhältnissen.
A. Verschmelzungen sind simultane Verbindungen von Tönen: Intervalle oder Akkorde. Die Musik redet von konsonierenden und dissonierenden Intervallen. Jene sind vollkommene: Oktave, Quinte, Quarte; unvollkommene: Terz und Sext (3:5, 5:8). Dissonanzen sind Sekunden (8:9, 15:16) und Septimen (8:15, 4:7). Diese Unterscheidung hat mit dem Gefühlston nichts zu tun, ebensowenig mit den Schwebungen, sondern nur mit der größeren oder geringeren Einheitlichkeit des Gesamteindrucks. Oktave, Quinte und Quarte klingen etwas leer, einfach; voller die Terz und Sext; zu zwiespältig die Dissonanzen. Das sind bereits wichtige Elemente des ästhetischen Eindrucks der Musik. Daher werden wir sie sogleich hier würdigen. Zuvor sei nur noch bemerkt, daß einer Messung der Verschmelzungsgrade sehr große Schwierigkeiten im Wege stehen.
a) Die Verschmelzung hängt ab von der Qualität der Komponenten. Die erwähnte Ordnung der Intervalle innerhalb der Oktave gilt allgemein; also ist der Verschmelzungsgrad derselbe, wenn die Schwingungsverhältnisse dieselben sind. Wichtig für den Aufbau einer musikalischen Skala sind nicht gleiche Unterschiede, sondern gleiche Verschmelzungsstufen. Ferner ist die Abweichung von der Verschmelzungsstufe um so merklicher, je höher sie von vornherein ist. Wir sind also um so empfindlicher für die Reinheit des Intervalls, je konsonanter es ist. Das ist wichtig und auch prak-
tisch für den Stimmer. Verstimmungen wirken wie Dissonanzen. Geht man über die Oktave hinaus, so erhält man eine ähnliche Reihe mit der Doppeloktave (1:4), der Duodezime (1:3), der Undezime (3:8) usw.; aber alle diese Stufen bleiben nach meiner Beobachtung hinter den entsprechenden Stufen innerhalb der Oktave etwas zurück in der Innigkeit der Verschmelzung.
b) Die Verschmelzung hängt ferner ab von der Intensität der Töne des Intervalls. Dabei ist eine Änderung der absoluten Intensität bis auf eine obere und eine untere Grenze ohne Einfluß; hier erklingen beide Töne gleich laut. Dagegen übt die relative Intensität eine große Wirkung. Beim Verhältnis 1:1 werden beide Töne in ihrer Selbständigkeit durch die Verschmelzung gleichermaßen beeinträchtigt. Bei ungleicher Intensität verschiebt sich der Schwerpunkt des Gesamteindrucks nach dem stärkeren Ton zu und der schwächere beginnt diesen zu färben, wobei er als selbständiger Faktor aufhört. (Die Gesamtsumme der wechselseitigen Hemmung bleibt vielleicht dieselbe.) Dies wird in doppelter Weise für die Musik wichtig. Nur so wird eine Hervorhebung führender Töne, der Melodie, und ein Zurücktreten der harmonischen Begleitung möglich. Nur so lassen sich Tonkomplexe als gefärbte Einzeltöne oder Klänge verwenden. Die Klangfarbe ist keine Eigenschaft der einfachen Töne, sondern eine Resultante aus mehreren einfachen. Dabei sind es die sogenannten Obertöne, deren relativ schwächeres Ertönen eine Färbung des Grundtones bewirkt. Hier ist eine große Mannigfaltigkeit nach Zahl, Qualität und Stärke der Obertöne möglich; daher den verschiedenen Instrumenten eine ausgeprägte Individualität eignet. Daß hier die Verschmelzung so vollkommen ist, ist aber nicht nur eine Folge der geringeren Intensität der Obertöne, sondern auch eine Folge der hohen Verschmelzungsstufen, die in dem Verhältnis von Grundton und Obertönen hervortreten (1:2:3:4:5). Es kommt vor, daß nicht der Grundton, sondern der erste Oberton der deutlichste oder führende Ton ist, namentlich in tiefer Lage,
weil die tiefen Töne geringe Empfindungsstärke aufweisen. Die Obertöne lassen sich bei relativer Verstärkung durch Resonatoren oder mit eigens auf sie gerichteter Aufmerksamkeit heraushören. Das ist Kompensation der Reizverhältnisse. Die Tatsache der Klangfarbe ist von größter Wichtigkeit für die Musik. Durch die Verschiedenheit der Klangfarben treten eigentümliche Wirkungen auf, die von Wert sind für die ästhetische Leistungsfähigkeit der Musik. Man denke nur an die verschiedene Klangfarbe von Trompete, Geige und Klarinette. Die menschliche Stimme hat eine verschiedene Klangfarbe bei verschiedenen Vokalen und verschiedenen Stimmungen; gepreßt und tonlos klingt sie in der Verzweiflung und im Trübsinn, klangvoll bei mutiger und freudiger Gemütsverfassung, scharf, schneidend bei boshafter Regung. Nun ist überhaupt bei musikalischen Wirkungen von großer Bedeutung der assoziative Faktor: die Erinnerung an den Tonfall, den rhythmischen Wechsel, kurz den Ausdruck des Sprechenden. Durch die Verschiedenheit der Klangfarbe wird dazu ein Beitrag geliefert. Eine Melodie, die zuerst von den Streichern, dann von den Bläsern gebracht wird, macht in beiden Fällen einen sehr verschiedenen Eindruck, was Variationen ungemein beleben kann.
c) Die Verschmelzung
hängt von der Anzahl der Töne ab, die zugleich
erklingen. In Akkorden wie 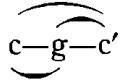 oder
oder 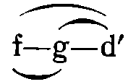 bilden sich mittlere Verschmelzungsgrade. Dies ist auch
für die Musik von großer Bedeutung, weil
nämlich die dissonanten Intervalle dadurch eine Milderung
erfahren; vgl. d–f–g–h. Ebensolches
geschieht, wenn auch die Grenzen
der Oktave überschritten werden. Bei
größerer Vermehrung der simultanen Klänge
spielt noch die Enge des Bewußtseins mit. Die Verschmelzung
bei Klängen ist nicht notwendig dieselbe wie bei
Tönen. Bei gleichem Grundton und verschiedener Klangfarbe
(unisono) sieht man das besonders deutlich. Die Oktave hat bei
Klängen stärkere Verschmelzung
bilden sich mittlere Verschmelzungsgrade. Dies ist auch
für die Musik von großer Bedeutung, weil
nämlich die dissonanten Intervalle dadurch eine Milderung
erfahren; vgl. d–f–g–h. Ebensolches
geschieht, wenn auch die Grenzen
der Oktave überschritten werden. Bei
größerer Vermehrung der simultanen Klänge
spielt noch die Enge des Bewußtseins mit. Die Verschmelzung
bei Klängen ist nicht notwendig dieselbe wie bei
Tönen. Bei gleichem Grundton und verschiedener Klangfarbe
(unisono) sieht man das besonders deutlich. Die Oktave hat bei
Klängen stärkere Verschmelzung
als bei Tönen. Darum können Akkorde auf verschiedenen Instrumenten verschieden klingen.
Der wichtigste Unterschied der Akkorde liegt im Durund Mollakkord vor. Der Gesamteindruck ist sehr verschieden. Der Durakkord klingt einheitlicher, Helmholtz nannte ihn deshalb auch die vollkommenere Konsonanz. Bei Klängen ist das insofern natürlich, als beim Molldreiklang (c es g) herbere Dissonanzen in den Obertönen eintreten müßten als beim Durdreiklang. Aber da bei einfachen Tönen der Gesamteindruck eine ähnliche Verschiedenheit aufweist, genügt diese Erklärung nicht. V. Öttinger und nach ihm Riemann haben daher Dur- und Molldreiklang als Gegensätze aufgefaßt, indem sie e und g als Obertöne, as und f als Untertöne zu c deuteten. Das ist aber, solange die Hörbarkeit von Untertönen nicht bewiesen ist, rein theoretisches Räsonnement. Das gleiche gilt für die Klangverwandtschaft, die Wundt zur Erklärung heranzieht. Nach ihm besteht eine direkte Klangverwandtschaft bei gemeinsamen Obertönen; je geringer deren Ordnungszahl und je zahlreicher sie sind, um so größer wäre die Klangverwandtschaft. Eine indirekte Klangverwandtschaft bestünde bei gemeinsamem Grundton; je näher er liegt, um so größer wäre die Verwandtschaft. Nun liegt beim Durakkord der erste gemeinsame Oberton 3 Oktaven und 1 Terz hoch, beim Mollakkord nur 1 Doppeloktave hoch. Umgekehrt verhält es sich mit dem gemeinsamen Grundton. Da nun aber die direkte Klangverwandtschaft das stärkere Prinzip ist, so würde hieraus folgen, daß der Mollakkord der konsonantere sei, was den Tatsachen evident widerspricht. Auch sonst ist dies Prinzip unvermögend, etwas zu erklären. Denn nach ihm müßte z. B. ein gewaltiger Unterschied zwischen Klängen und Tönen bestehen, ferner zwischen Klängen verschiedener Klangfarbe. Sodann hätte nach diesem Prinzip die Duodezime (1:3) größere Konsonanz als die Doppeloktave (1:4), und es bestünde kein Unterschied der Konsonanz zwischen der kleinen Terz (5:6) und der kleinen Septime (4:7). Endlich ist nicht einzusehen,
wie eine so schwache Beziehung (die individuelle Klangverwandtschaft), die noch dazu bei tieferen Tönen ganz zum Verschwinden gebracht werden kann, überhaupt so tiefgreifende und konstante Unterschiede soll erklären können. Die Erklärung für Dur und Moll kann wohl nur darin gesucht werden, daß es einen wesentlichen Unterschied für den Gesamteindruck macht, wie die Verschmelzungsgrade geordnet sind: die große Terz über oder unter der kleinen. So klingen auch cdg und cfg wesentlich verschieden. Doch ist auch das noch genauer zu prüfen; Für unser Gehör sind Dur und Moll die einzigen Akkorde, die einen Abschluß gewähren, und auf ihnen ist daher das gesamte polyphone Material aufgebaut. In bezug auf den Stimmungsgehalt der Akkorde kann man sie in bestimmte und unbestimmte einteilen. Zu jenen gehören die Dur- und Mollakkorde in allen Lagen, zu diesen die Septimenund Nonenakkorde. Während jene entweder Trost, Beruhigung, Freude, Stolz, Mut oder Verzweiflung, Wehmut, Trauer, Kleinmut, Bescheidung ausdrücken, wird durch diese dem Zweifel, der Unsicherheit, dem Schwanken, der Unruhe Stimme verliehen. Große Wirkungen können dadurch erzielt werden, wie z. B. von Beethoven vor dem Finale in der 5. Symphonie die lange Spannung durch Septimenakkorde angedeutet worden ist, oder von Brahms im 3. Satz des Requiems die Stimmung der Frage und des Zweifels. Je schärfer die Dissonanz, um so stärker der Ausdruck.
d) Die Verschmelzung hängt ab von der Tondifferenz. Die Unterscheidbarkeit ist bei simultanem Erklingen nahe beieinanderliegender Töne wesentlich abgestumpft. Während bei sukzessiver Darbietung die Schwelle = 1/3 S ist, beträgt sie bei simultaner 16 S, also 50 mal soviel. Das ist wichtig für die Größe der Stufen in der Musik. Dies Moment ist es, welches uns die etwas geringere Verschmelzung bei den analogen Intervallen über die Oktave hinaus erklären hilft. Denn zwei Töne lassen sich um so leichter unterscheiden, je weiter sie voneinander entfernt sind. Es durchkreuzt diese
Bedingung die andere der Qualitätsstufen. In der Musik macht man gern von diesem Umstand Gebrauch, indem man sonst gut verschmelzende Intervalle durch eine oder mehrere Oktaven voneinander trennt, sog. weite Lage einführt, um dadurch den Verschmelzungsgrad etwas zu ermäßigen. Auch ist dies Moment bei der Schätzung der Verschmelzungsstufen der einzelnen Intervalle zu berücksichtigen. Warum macht wohl die große Terz den angenehmsten Eindruck? Weil hier Einheitlichkeit und Zwiespältigkeit sich ungefähr die Wage halten. Bei der kleinen Terz überwiegt bereits die Zwiespältigkeit und kleine Abweichungen mißfallen besonders (stimmen traurig).
Bedeutungsvoll ist auch die Größe des Schrittes hinauf oder hinunter. Die Stimmung steigert sich mit der Weite des Schrittes und bleibt gleichmäßiger bei kleinen Schritten. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß auch assoziative Wirkungen anderer Art sich an den Fortschritt nach oben oder unten knüpfen können; nämlich Vorstellungen räumlicher Art, des Hohen und des Tiefen usw.
B. Das bisher Gesagte bezog sich auf die Simultaneität von Tönen oder Klängen. Wie verhält es sich nun mit der Ton- und Klangfolge?
a) Eine Folge gleicher Töne oder Klänge vermag uns rhythmisch zu interessieren. Wir gliedern sie nach der relativen Intensität und bilden uns so einen Rhythmus durch subjektive Betonung. Unter Umständen kann auch die dynamische Veränderung als solche (cresc. oder decresc.) einen ästhetischen Eindruck hervorrufen. Sodann können die begleitenden Harmonien wechseln (wie bei Beethoven in der Appassionata). Auch das wirkt dann nicht als Folge gleicher Töne. Endlich kann diese letztere durch sich selbst als Wiederholung einen gewissen Eindruck machen, und zwar den des Gleichförmigen oder Einförmigen, und es kann dies durch Assoziationen eine Fülle von Gedanken herbeirufen (an gleichförmig niederrauschenden Regen etwa, an den gleichförmigen Ablauf des Lebens, an das Einerlei des Tages) und
dadurch wieder mannigfaltige Stimmungen, die sich mit diesen Gedanken verknüpfen. Auch zur nachdrücklichen Betonung oder Hervorhebung kann die Wiederholung dienen. Je nach der Geschwindigkeit, mit der die gleichen Klänge einander folgen, wird zugleich die Stimmung eine wesentlich andere; ruhiger wird sie bei langsamerer, aufgeregter bei rascherer Folge.
b) Eine Folge verschiedener Töne, soweit sie den Mindestanforderungen genügen, die Musiktheorie für die schlichteste melische Bindung verlangt, nennt man gewöhnlich Motiv. Oft bringt Aufwärtsbewegung in das Motiv ein Moment der Spannung, der Erwartung, der Freude oder des Mutes; ebenso kann die Abwärtsbewegung eine Tönung von Beruhigung, Erfüllung, Trauer oder der Resignation hervorrufen. Der Gesamtausdruck eines Motivs hängt aber noch von vielen anderen Komponenten ab. Mollfolge bewirkt im allgemeinen eine traurigere Stimmung, Durfolge eine frohere. Sehr entscheidend sind dynamische und rhythmische Gliederung. Hierin folgt der Ausdruck ganz dem bei Gebrauch unserer Stimme herrschenden. Doch braucht jene Wirkung keineswegs bloß diese assoziative Bedingung vorauszusetzen, weil es nicht notwendig erscheint, daß die entsprechenden Wirkungen der Rede anderer bloß assoziativ begründet sind.
Nicht zu vergessen ist bei alledem, daß ein Auf- und Niederschritt auch die Harmonie oder Disharmonie bedingt. c-g macht in der G-dur-Tonart einen anderen Eindruck als in C-dur. Dort führt er zum Abschluß, zur Tonika, hier entfernt er sich von ihr. Ferner sinkt gegen den Schluß eines Gedankens unsere Rede in der Regel (falls sie nicht eine Frage enthält), auch wenn er frohen Inhalts ist; und so schließt auch eine Melodie vielfach herabsteigend, ohne da mit jene oben angedeuteten Stimmungen hervorrufen zu müssen. Nur in der Entfernung von der Tonika kann das Entscheidende liegen, die spätere Rückkehr ist nicht entscheidend. Dafür finden sich zahlreiche Beispiele in Volks- und Kunstliedern; man vgl. „Wohlauf noch getrunken“, „Der
Sang ist verschollen“, „Immer leiser wird mein Schlummer“ (Brahms).
Motive sind die Grundgedanken der musikalischen Komposition, die Sukzessionseinheiten derselben. Wie in der Architektur ein bestimmtes Ornament, eine Linienführung das Hauptglied bildet, so in dem Musikwerk das Motiv, das bald in der führenden Melodie, bald in der Begleitung, in verschiedenen Tonarten, mit kleinen Veränderungen des Rhythmus und der Tonfolge erscheinend, den immer wiederkehrenden Grundstock eines ganzen Satzes auszumachen pflegt. In das Motiv pflegt man daher auch vorzugsweise die Charakteristik des Tonstücks zu verlegen. Mit ganz besonderer Kunst hat Wagner seiner Ausbildung obgelegen.
Durch die Tonleiter erhalten Dur und Moll eine neue Charakteristik. Die größere Unregelmäßigkeit im Aufbau, die größere Dissonanz ist zweifellos der Molltonleiter zu eigen. Auf allen Stufen, in allen Tonarten bleibt der Aufbau der Tonleitern derselbe. Trotzdem gibt man in den Kreisen der Komponisten und der Genießenden einen deutlichen Unterschied zwischen den einzelnen Tonarten an, und zwar keineswegs aus dem Grunde nur, weil die Grenzen der musikalisch verwendbaren Töne für die verschiedenen Tonarten verschieden lägen und ebenso für die verschiedenen Instrumente berücksichtigt werden müßten. Es liegen auch bestimmte Charakteristiken der Tonarten vor: das helle, freundliche D-dur, das majestätisch feierliche C-dur. Näheres kann man hierüber nur durch Versuche zu erfahren hoffen, die dasselbe Motiv in verschiedenen Tonarten zu bringen hätten. Das Studium von Liedern und besonders von Wagnerschen Opern wäre auch hierfür sehr instruktiv. An solchen vergleichenden Studien fehlt es überhaupt in der Ästhetik sehr.
C. Die dynamischen Verhältnisse.
a) Gleiche Stärke kann den Eindruck des Beständigen, Einförmigen, Gleichmäßigen hervorrufen. Je größer die absolute Stärke, um so eindringlicher oder erschütternder kann sie wirken. Gleiche objektive Stärke bedeutet jedoch keines-
wegs gleiche scheinbare Stärke. Durch die rhythmische Gliederung bilden sich hier vielmehr alsbald scheinbare Intensitätsunterschiede aus. Es ist nun ein allgemeines psychologisches Gesetz, daß Bevorzugung durch die Aufmerksamkeit so wirkt wie Verstärkung, Zurücksetzung wie Abschwächung. Doch läßt sich nicht schlechthin mit Engel sagen: Das Starke entspricht dem Festen, Entschiedenen, das Schwache dem Spielenden, leichten; die assoziativen Faktoren sind weit mannigfaltiger. Es kann auch das Starke Plumpheit oder Furchtbarkeit, das Schwache Anmut oder Zartheit bedeuten. Auf alles, was der Gradabstufungen fähig ist (und das sind alle Gemütsbewegungen), läßt sich der Unterschied von Stark und Schwach anwenden.
b) Verschiedene Stärke. Der Übergang zu stärkeren Tönen bedeutet eine Steigerung vom Geringeren zum Größeren, vom Bedeutungsloseren zum Bedeutungsvolleren, dagegen nicht (wie Engel behauptet) vom leichteren zum Erregteren; denn das würde ein qualitativer Umschlag in der Stimmung sein, während zunächst nur eine quantitative Änderung der gleichen Qualität von Stimmung und Affekt dadurch begründet sein kann. Der Übergang zu schwächeren Klängen bedeutet entsprechend eine Herabminderung. Diskrete Verstärkung oder Abschwächung wirkt anders als kontinuierliche. Es ist der Vorzug der Streich- und Blasinstrumente vor den Tastinstrumenten, daß sie diese beim gleichen Ton mit Leichtigkeit vermögen. Dadurch sind gewisse Effekte dem Klavier unzugänglich, so z. B. das beliebte cresc. und decresc. des Schlußakkords, das dann nur durch ein Tremolieren ersetzt werden kann. Die kontinuierliche Steigerung oder Schwächung wirkt sanfter überleitend als die diskrete. Der Stärkeunterschied bringt ein Moment der Kontrastwirkung hinzu. Ein schwacher Klang erscheint im allgemeinen um so schwächer, je stärker der Klang war, der ihm vorausging, und umgekehrt. Der Affekt der Überraschung kann hervorgerufen werden, wo plötzlich dynamische Änderungen eintreten. Vgl. in Haydns Schöp-
fung: „Und es ward Licht,“ wo sich zugleich c-moll nach c-dur wandelt. Verbindet sich wie hier mit der quantitativen die qualitative Änderung, so kann der Effekt gewaltig sein. Bei kontinuierlicher Steigerung oder Schwächung ist auch die Geschwindigkeit von Einfluß, mit der sie sich vollzieht. Die Affekte werden entweder allmählich geändert oder mit Schnelligkeit. Im letzteren Falle nähert sich die Wirkung dem diskreten Übergang. Der assoziative Faktor der Stimmstärke ist auch hier von Wichtigkeit. Wir betonen das Wichtige und lassen das Unwichtige dynamisch zurücktreten. Andererseits liebt sich die Freude (nicht das wortlose Glück) laut, die Trauer in gewissen Graden leise zu äußern. Der Zorn bricht aus, Verzweiflung und Wut ebenfalls; die Hoffnungslosigkeit tritt in schwacher, klangloser Rede hervor. Doch darf man das natürlich nicht ohne weiteres umkehren, schon deshalb, weil mannigfache Stimmungen die gleiche Ausdrucksstärke verwenden. Gern paart sich melischer Aufschritt mit dem Crescendo, Niederschritt mit dem Decrescendo. Das liegt an der Verwandtschaft beider Stimmungsmittel. Doch ist die Verknüpfung natürlich nicht notwendig.
D. Zeitliche Verhältnisse. Der Ton erfüllt eine Zeitspanne; er hat Geltung. Durch längere Dauer kann ein ähnlicher Eindruck hervorgerufen werden wie durch größere Intensität. Das Größere, Wichtigere, Nachhaltigere, aber auch das Bleibende, Beständige, Ruhende kann dadurch ausgedrückt werden. Töne mit langer Geltung sind deshalb die natürlichen Ruhepunkte. Vielfach wird mit ihnen begonnen, ehe die lebhaftere Bewegung anhebt (vgl. Wagners Rheingold-Vorspiel), häufig auch damit geschlossen. Ferner wird durch den Gegensatz des staccato und legato mancher Effekt hervorgebracht. Im staccato liegt etwas Aufgeregtes, Unruhiges, Wildes, auch wohl einmal Zaghaftes, im legato Ruhe, Trost, Gleichmaß. Außerdem können dadurch Vorgänge von entsprechender zeitlicher Erstreckung angedeutet werden: ein Springen oder Hüpfen durch staccato, ruhiges Schreiten durch legato.
Von Pausen spricht man in der Musik schon, wenn eine Stimme aussetzt, während die anderen des polyphonen Satzes weitertönen, sodann wenn die ganze Tonbewegung für eine kurze Spanne unterbrochen wird. Infolge der durch die schon verflossene Musik eingeübten rhythmischen Gliederung verliert man auch während einer völligen Pause, auch wenn sie länger dauert, niemals den Faden; man weiß sehr genau, ob zu früh oder zu spät wieder eingesetzt wird. So gibt es keine absoluten Pausen. Schon zur Abwechslung und Erholung sind Pausen erforderlich; darin besteht ihre negative Bedeutung. Fugen machen uns vielleicht auch deshalb einen so künstlichen Eindruck, weil ohne Rast die Stimmenbewegung weitergeht. Eine positive Bedeutung erhält die Pause nur, wenn sie länger ist als gewöhnlich. Sie kann sehr überraschend, fast beängstigend und sehr spannend wirken, wenn nach lebhafter Bewegung eine längere Pause eintritt. So z. B. Götterdämmerung (Klavierauszug, S. 130): Brünnhilde fragt bei lautlosem Schweigen des Orchesters „Wer bist du, Schrecklicher?“ Eine Fermate über der Pause deutet eine unheimlich lange Stille an. Ebenda (S. 321): Gutrune lauscht an Brünnhildens Tür und ruft bei völligem Schweigen des Orchesters „Brünnhild, bist du wach?“ Es antwortet ein mit Fermate versehener pausierter Takt. So kann die Pause eine Stille, aber auch alle Stimmungen der Stille ausdrücken. Vielfach wird eine größere Pause angewandt, um etwas Neues vorzubereiten, wie in der Ouvertüre zum Freischütz vor dem Eintritt des C-dur-Schlusses. Man kann sich so einen kontinuierlichen harmonischen und melodischen Übergang ersparen. Doch kommt für die Wirkung sehr viel auf die aktuelle Länge an. Wird die Pause zu lang, so wirkt sie ermüdend; ist sie zu kurz, so trifft uns das Neue unvorbereitet. Hier hat der Takt des ausübenden Musikers einen weiten Spielraum. Von besonderer Wichtigkeit ist es, daß die Aufmerksamkeit des Hörenden normalerweise nie auf die leere Zeit als solche, sondern auf den Zeitinhalt gerichtet sei. Nun erscheint uns aber eine erlebte Zeit um so kürzer, je
weniger dem zeitlichen Moment selbst die Aufmerksamkeit zugewandt gewesen ist. Damit also Pausen als solche eindrucksvoll werden, dürfen sie schon ein bißchen lang sein. über die intimeren Verhältnisse, die zwischen der Beurteilung erfüllter und der leerer Zeiten bestehen, fehlt es noch an genügenden Aufschlüssen. Intervalle, durch stärkere Eindrücke abgegrenzt, erscheinen kürzer, als gleich lange, durch schwächere abgegrenzt (Irradiation).
c) Die Wiederholung ist ein äußerst wichtiger Faktor in der Musik. Sie ist hier von ganz anderer objektiver Bedeutung als bei den übrigen Künsten, weil das Behalten von Motiven, Harmonien und Themen viel schwieriger ist, als das Behalten von im Gedicht niedergelegten Gedanken oder Stimmungen, während bei der bildenden Kunst vollends das Nebeneinander die Vergleichung sehr erleichtert. Wie könnte eine Übersicht über den Inhalt und die Gliederung des musikalischen Kunstwerks gewonnen werden, wenn nicht eine Wiederholung stattfände. Sie ist aber außerdem als ästhetischer Faktor von großer Bedeutung; denn durch die Wiederholung vor allem kommt das für die ästhetische Beurteilung so wichtige Verhältnis zwischen den Einzeleindrücken und dem Gesamteindruck zustande. Auf die Wiederholung der Harmonien kommt es hierbei nicht an, sondern nur auf die Wiederholung der Motive des führenden melodischen Elements.
d) Das Tempo, die Geschwindigkeit der Tonfolge, muß schon deshalb von großem Einfluß sein, weil die Geltung und die Pause dadurch bestimmt wird; und in der Tat tritt ein großer Umschwung im Charakter eines Musikwerkes ein, wenn man es wesentlichen Tempoänderungen unterzieht. Es kann dadurch ganz unkenntlich werden. langsam und rasch, diese relativen Bestimmungen werden durch zahlreiche Abstufungen in Verbindung mit der Geltung der Noten genauer festgelegt: Adagio, andante, allegretto, allegro, presto. Dazu ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts das Metronom getreten; wodurch in annähernd absolutem Maße das Tempo
angegeben werden kann. In den tiefen Lagen wirkt die Geschwindigkeit anders als in den hohen, weil die Nachwirkung bei tiefen Tönen länger dauert als bei hohen. Ruhe, Bedächtigkeit, Behäbigkeit, Feierlichkeit spricht aus der langsamen Bewegung der Töne zu uns. Alles, was sich mit den Vorstellungen der Ruhe assoziiert, tritt auch hier hervor, Näheres und Entlegeneres. Auch die großartige Erhabenheit kleidet sich in ruhige Bewegung. Unruhe, Aufregung, Lebhaftigkeit, Leichtigkeit spricht aus der raschen Bewegung der Töne. Alles, was sich mit der Vorstellung der Lebhaftigkeit assoziiert, kann gleichfalls dadurch erweckt werden und seinen Stimmungscharakter hinzufügen. Das Anmutige und Zierliche wird in schnellerer Folge geboten. An sich heiter dagegen ist das Schnelle keineswegs; ebensowenig wie an sich traurig das langsame. Trauermärsche gehen langsam, aber auch stets in Moll. Es gibt eine heitere Ruhe, wie eine traurige Aufregung. Wiederum bezieht sich das Schnelle und das langsame hauptsächlich auf das Motiv, den melodischen Fortschritt. Daher läßt sich auch bei unbekannter Geltung der Noten wohl angeben, ob etwas langsam oder schnell gemeint ist, was Wallaschek zu schroff bestreitet. Es stört den Eindruck der Ruhe nicht, wie rasche Figuren die führende Stimme umspielen. Von besonderer Wirkung ist das tempo rubato und das Rezitativ, wo die Geschwindigkeit ganz von dem Charakter der Töne und ihrer Verbindung, sowie von den begleitenden Worten abhängig gemacht wird.
Beschleunigung und Verlangsamung (accelerando-ritardando) bedeuten zunächst nichts anderes, als den Übergang zu größerer Erregung oder größerer Ruhe. Doch braucht auch ein solcher Übergang nicht kontinuierlich zu sein, er ist vielfach diskret. Aber die Wirkung ist gerade bei dem kontinuierlichen Übergang auch eine eigentümliche, weil hier eine empfindliche Hemmung des eingeübten Flusses stattfindet und damit zugleich zu etwas Neuem übergeleitet werden kann. So wird vielfach die Reprise in der Symphonie mit einem ritardando eingeleitet, was eben die Aufmerksam-
keit auf etwas Neues richtet. Umgekehrt wird das accelerando zu einer Steigerung benutzt; indem derselbe Gedanke in größerer Hast erklingt, wirkt er fortreißender. So wird vielfach gegen das Ende hin die Bewegung schneller. Natürlich kann auch das Zaudern durch ein ritardando, das Drängen durch ein accelerando ausgedrückt werden; ebenso eine Fülle assoziativer Beziehungen. Je rascher sich ein accelerando oder ritardando vollzieht, um so überraschender ist die Änderung.
Die Rhythmenbildung vollzieht sich in der Weise, daß ein akusto-motorischer Eindruck gegenüber einem oder zwei anderen betont wird. Diese Auszeichnung eines Elements ist an keine ausschließliche Bestimmung gebunden. In der Tat wird man finden, daß alle Besonderheit, welche unsere Aufmerksamkeit zu fesseln vermag, daß ein Qualitätsunterschied ebensogut wie ein Intensitätsunterschied und ebenso wie ein Dauerunterschied zur Rhythmenbildung veranlaßt. Das ist nun für die Musik von großer Bedeutung. Hiernach kann sich der Charakter eines Motivs durch lntensitätsverteilung und durch die Zeitverhältnisse bestimmen. Darum ist es falsch, wenn man alles auf ein Schema, etwa die Intensität reduzieren will und sogar meint, daß stärkere Angabe einzelner Töne immer den Rhythmus beeinflusse, während es sich oft nur um Phrasierung handelt. Hat sich einmal ein Rhythmus gebildet (wozu nur wenige Wiederholungen der Grundfigur erforderlich sind), und hat er sich befestigt (was auch recht bald eintritt), so wird dem Hörenden sehr leicht, ihn fortzusetzen; auch wenn die ursprünglich ihn bildenden Bedingungen aufgehört haben. Das ist in doppelter Hinsicht von Wichtigkeit: erstens, weil der Komponist nach eingeübtem Rhythmus frei schalten und walten kann mit Pausen und indifferenten Figuren; zweitens, weil der Übergang zu einem neuen Rhythmus mit der eingeübten Bindung zu kämpfen hat und daher besonders scharf zu markieren ist. Wir brauchen manchmal mehrere Takte, bis wir den subjektiven Zwang überwunden haben, in der alten Weise zu be-
tonen. Zu außerordentlich reizvollen Wirkungen führt auch ein doppelter Rhythmus, der sowohl um seiner selbst willen verwendet wird, wie auch, um einen eingeübten Rhythmus, zu dem man zurückkehren will, nicht ganz aufhören zu lassen.
Die Formen, in denen Rhythmusbildungen sich vollziehen, sind ziemlich mannigfaltig. Die Musik drückt sie im Takt aus. Dieser wird so gewählt, daß er den herrschenden, oder wenigstens anfänglichen Rhythmus andeutet. Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Takte. Die ersteren sind entweder zwei- oder dreiteilig: 2/4, 2/2; 3/4, 3/8. Die zusammengesetzten sind zweiteilig (gerade): 4/4; dreiteilig (ungerade): 9/4, 9/8; gemischt: 6/4, 6/8; doppelt zusammengesetzt 12/8. 5/4 - Takt kommt selten vor. Der Unterschied von Vierteln, Achteln usw. ist nur für die Geltung und das Tempo von Bedeutung, nicht aber für die rhythmische Form.
Man hat geglaubt, nur den zweiteiligen und den dreiteiligen Rhythmus als selbständige Formen ansehen zu müssen und alle mehrgliedrigen als Kombinationen jener einfachen auffassen zu sollen. Das ist gewiß richtig; dann muß man aber hinzufügen, daß die mehrgliedrigen Rhythmen einen ganz selbständigen Eindruck hervorrufen, als eigentümliche Ganze aufgefaßt werden.
Die ästhetische Bedeutung des Rhythmus ist zunächst durch einen Unterschied bedingt, der zwischen einer selbständigen und einer bloß dienenden Stellung desselben besteht. In der Regel ist ihm die letztere angewiesen. Die Aufmerksamkeit richtet sich daher nicht auf ihn, sondern auf den in dieser Form erscheinenden Inhalt. Die Motive haben ihre eigenen Betonungsgesetze, die Themen führen zu besonderen Höhepunkten, die durch längere Geltung, besonderen Anschlag und dgl. ausgezeichnet werden. Der Rhythmus hat sich hier überall dem stärkeren Interesse unterzuordnen,
und umzuschlagen, wenn es eine bestimmte Tonfolge verlangt. So wirkt nichts unangenehmer, als wenn er dem melodischen oder harmonischen Zusammenhang Gewalt antut. Nicht zu stören ist hier seine Aufgabe. Selbständig ist der Rhythmus vor allem in einer Gattung Musik, die zur Markierung des Rhythmus mithelfen soll, also bei Tänzen und Märschen; aber auch sonst zuweilen, wie z. B. in Beethovens C-Moll-Symphonie vor dem Finale, wo 15 Takte hindurch die Streichinstrumente einen Akkord pp aushalten, während die Pauke rhythmisch wirkt. Über die ästhetische Bedeutung der einzelnen Rhythmen läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Besonders wirksam ist der Wechsel von Rhythmen oder die Kombination von steigenden und fallenden Rhythmen. Dadurch kommt ein gewisses Schwanken in die Stimmung des Hörers; ein gewisser Übermut kann sich dadurch ausdrücken. Nähere Aufklärung ist aber erst von besonderen Experimenten zu erwarten. Mannigfaltigkeit der Rhythmen und überhaupt der Zeitverhältnisse ist ein Hauptmoment bei der ästhetischen Wirkung der Musik.
Literatur:
Zeising, Ästhetische Forschungen.
Frankfurt am Main 18.55.
Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. 7.
Aufl. Leipzig 1885.
Wagner, Oper und Drama. 1851.
Helmholtz,
Die Lehre von den Tonempfindungen. 4. Aufl. Braunschweig
1877.
Krueger,
Das Bewußtsein der Konsonanz. Leipzig 1903.
Riemann,
Die Elemente der musikalischen Ästhetik.
Berlin und Stuttgart 1900.
Wallaschek,
Anfänge der Tonkunst. Leipzig 1903.
Stumpf, Die
Anfänge der Musik. Leipzig 1911.
***
Wenn wir die verschiedenen experimentellen Ergebnisse über die elementare ästhetische Wirkung übersehen, so findet sich, daß die einzelnen Teile der gefallenden Form ein anschauliches Ganzes bilden. Es ist dies die Einheit in der Mannigfaltigkeit, die alte Forderung, die so oft in der Ästhetik
erhoben worden ist. Die einzelnen Teile müssen sich einer übersichtlichen Ordnung einfügen; nicht zufällig dürfen sie nebeneinanderstehen, sie müssen sich gesetzmäßig aufbauen. Das ist die alte Forderung der Symmetrie und des Ebenmaßes. Daß ein unmittelbarer Proportionsvergleich mit großer Genauigkeit durchführbar ist, hat Bühler in seinem ausgezeichneten Buch über die Gestaltwahrnehmung dargetan. Wenn Zusammenhang und Aufbau nicht allzu leicht durchschaut werden können, so erhöht sich das Wohlgefallen, zu schwierige Auffassung mißfällt wiederum.
Der direkte Faktor übt somit, auch für sich genommen, eine ästhetische Wirkung aus, er verdankt also nicht alle ästhetische Wirkung dem relativen Faktor. Der so entstehende Dualismus der ästhetischen Wirkungen schreckt uns nicht. Wir fühlen uns durch die Tatsachen gesichert.
Literatur:
Lalo,
L’esthétique
experimentale contemporaine. Paris 1908.
Larguier des
Bancels, Les méthodes de l’esthetique
expérimentale. L’année
psychologique, 1900, Bd. 6, S. 144-190.
Külpe, Der gegenwärtige Stand der experimentellen
Ästhetik. Bericht über den II. Kongreß
für experimentelle Psychologie, Leipzig 1907. Vgl. Th. Ziehen.
Zeitschr. f. Ästhetik, Bd. 9, S. 16-46.
Fechner,
Zur experimentellen Ästhetik. 1871.
Abhdlgn.
d. math.-phys. Klasse der Kgl. sächs. Gesellschaft der Wiss.,
Bd. 9, S. 555ff.
Preyer, Seele des Kindes. Leipzig 1895, 4. Aufl.
Bühler, Die Gestaltwahrnehmungen. Stuttgart 1913, Bd. 1.
Pierce, Aesthetics of simple Forms. Psychological Review, 1894, Bd. 1,
S. 483ff.; 1896, Bd. 3, S. 270ff.
Kaestner,
Untersuchungen über den Gefühlseindruck
unanalysierter Zweiklänge. Wundts Psychol. Studien, 1909, Bd.
4.
Meumann, Untersuchungen zur Psychologie und Ästhetik des
Rhythmus. Philos. Stud., Bd. 10 und 15.
Bolton,
Rhythm. Americ. Journal of Psych., 1893, Bd. 6, S. 146ff.
Külpe, Über den assoziativen Faktor des
ästhetischen Eindrucks. Vierteljahrschrift
f. wiss. Philos., 1898, H. 23.
Lipps, Ästhetische Einfühlung. Zeitschr. f. Psychol.,
1900, Bd. 22.
Witasek, Zur psychol. Analyse der ästhetischen
Einfühlung. Zeitschr. für
Psychol., 1901, Bd. 25.
Tumarkin,
Das Assoziationsprinzip in der Geschichte der Ästhetik. Arch.
f. Gesch. d. Philos., 1898, Bd. 12.
Gordon,
Esthetics of simple color arrangements. Psychol. Review, 1912,
Bd. 19, S. 352.
Haines
und Davies, The psychology of aesthetic reaction to rectangular
forms. Psychol. Review, 1904, Bd. 11.
McDougall, Stetson, Puffer, Angier, Studies
in aesthetic processes. Psycholog. Review. Monograph Supplements, 1903,
Bd. 4. (Harvard Psych.,
Studies, Bd. 1.)
Rowland,
Aesthetics of repeated space forms. Harvard Psych. Studies, Bd. 2.
Kirschmann,
Conceptions and Laws in Aesthetics. Toronto Studies, Psychol. Series,
Bd. 1 und 2.
Baker, Experiments on the Aesthetic of light and colour. Toronto
Studies,
Psychol. Series, Bd. 1 und 2.
Dobbie,
Experiments with School Children on colours combinations. Toronto
Studies, Psychol. Series, Bd. 1 und 2.
Seyfert, Über die Auffassung einfachster Raumformen. Wundts
Philos.
Studien, 1903, Bd. 18, S. 189.
Legowski, Beiträge zur experimentellen Ästhetik.
Archiv
für d. ges. Psychologie, Bd. 12, S. 236.
Prinzipien der ästhetischen Wirkung nennen wir die letzten umfassenden, für alle komplexen ästhetischen Eindrücke unter der Voraussetzung eines idealen ästhetischen Verhaltens geltenden Bestimmungen. Sie müssen für das Interesse an der merklichen Beschaffenheit und für das Gefallen und Mißfallen daran aufgestellt werden. Sie resultieren aus den Einzelgesetzen, die wir für den direkten Faktor, seine materialen und formalen Bestandteile finden, ebenso wie aus denen, welche die verschiedenen Formen des relativen Faktors und den Zustand bei ästhetischem Verhalten beherrschen. Sie sind Verallgemeinerungen, letzte Zusammenfassungen und bilden zugleich die Maßstäbe unserer ästhetischen Beurteilung, die Grundlagen unserer Wertung. Sie müssen so weit gespannt werden, daß die berechtigten Unterschiede der ästhetischen Empfänglichkeit darin zur Geltung kommen
können. Berechtigt sind sie aber, sofern sie mit dem idealen ästhetischen Verhalten verträglich sind. Hatten wir uns schon beim relativen Faktor, sowie beim ästhetischen Zustand auf die Kunst berufen, um ihre Wirkungen angeben zu können, so müssen wir dies künftig erst recht tun. Doch werden wir gelegentlich auch auf die Natur hinweisen, um nicht in die Fehler einseitiger Kunstästhetik zu verfallen.
Ästhetische Gemütserregungen erwachen nur, wo der Eindruck uns fesselt, uns interessiert. Wir haben nun gefunden, daß die ästhetischen Objekte ein einheitliches Ganzes bilden müssen, wenn sie uns fesseln und gefallen sollen. Das gilt für den direkten wie für den relativen Faktor. Folglich muß jedem ästhetischen Eindruck gegenüber prinzipiell die Forderung erhoben werden, daß das Interesse, das wir an ihm nehmen, selbst einheitlicher Natur sei und daß die einzelnen besonderen Interessen, die sich an dem komplexen Ganzen unterscheiden lassen, in geordneter Abstufung zueinanderstehen. Die Einheit des Interesses ist nicht nur da möglich, wo ein Eindruck allein vorhanden ist, wie bei einer einfachen räumlichen Form, sondern auch da, wo eine Mehrheit von Eindrücken im Neben- oder Nacheinander einen Gesamteindruck bildet, wie bei einer Landschaft oder einem Gedicht. Das alte Prinzip der Einheit des Mannigfaltigen bringt diesen zweiten Fall zum Ausdruck; wir finden eine Wurzel dieser Einheit im Interesse. Damit Einheit des Interesses möglich sei, muß der Eindruck ein in sich geschlossenes Ganzes sein, er muß sich von seiner Umgebung abheben und die einzelnen Teile müssen inniger miteinander als mit der Umgebung zusammenhängen. So hat jedes Kunstwerk seinen Rahmen, das Bildwerk seinen Sockel, das Schauspiel die Bühne, das Konzert die atemlose Stille. So wird der Gegenstand im Raum und in der Zeit isoliert, zur gesonderten Auffassung vorbereitet. Aber freilich, bei der Begrenztheit unseres Bewußtseins, unserer Aufmerksamkeit, würde die Einheit des Interesses niemals zustande kommen, wenn nicht Unterordnung und Überordnung die aufmerksame Erfassung
des Ganzen ermöglichte. Wären die Bestandteile des Komplexes ganz unabhängig voneinander, so würde sich das Interesse zersplittern und dadurch abschwächen. Darum muß die Abstufung des Interesses als die ästhetisch wirksame Form aufmerksamen Verhaltens angesehen werden. Die Abstufung macht die Unterordnung aller Nebeninteressen unter ein Hauptinteresse notwendig. Fehlt es am Zusammenhang der verschiedenen Interessen, so haben wir es mit einem bloßen Nebeneinander oder Nacheinander zu tun. Innerhalb des ästhetischen Gegenstandes muß also ein durch die Aufmerksamkeit isolierbarer Bestandteil das meistbetonte Zentrum des Interesses sein. Denn nur so läßt sich ein gegliederter Gesamteindruck gewinnen. Nur in verminderter Betonung können sich andere Interessen darum gruppieren. Das Wichtigere steht in engerer, das Unwichtigere in entfernter Beziehung zum Zentrum des Interesses.
Also nur durch die Unterordnung der Interessen, nicht durch die Nebenordnung erhält sich die Einheit eines in sich geschlossenen Ganzen. Um unsere Aufmerksamkeit zwanglos auf die abgestuften interesseweckenden Eindrücke zu verteilen, sind viele Hilfsmittel der Kunst erfunden worden. So pflegt die Malerei dem wichtigsten Bestandteil im Gemälde eine ausgezeichnete Stellung einzuräumen. Francia gibt seiner Madonna die Mitte des Raumes, Gozzoli stellt die drei Könige an die Spitze des Zuges, Tizian rückt das Wunder des heiligen Antonius in den Vordergrund, Correggio wirkt durch helle Beleuchtung, Botticellis Frühling durch gesättigte Farben die Betonung des Hauptinteresses. Lenbachs Manier hebt das Gesicht durch sorgfältige technische Ausführung hervor, Murillo wendet die Aufmerksamkeit von Nebenpersonen auf den entscheidenden Ort. Alle solche Faktoren können zusammenwirken, ihre Abstufung bringt die Abstufung des Interesses hervor. In anderen Künsten dienen andere technische Mittel diesem Zweck. Das Hauptthema des musikalischen Satzes wird vorbereitet, wiederholt, dynamisch verstärkt, verwoben, variiert. Die Hauptgestalt des
Epos handelt am meisten, um ihr Geschick dreht sich das Interesse der Nebengestalten, ihre Entwicklung läßt sich vollständig übersehen. Die französische Lehre von der Einheit der Handlung, des Raumes und der Zeit war einseitig, weil die Einheit des Interesses auch mit anderen Mitteln als den beiden letzten zu erreichen ist. Hauptmanns Weber haben keinen eigentlichen Helden und doch Einheit des Schicksals, der Stimmung, der Handlung, der Umgebung. Wie die Forderung der Einheit des Interesses verwirklicht wird, darüber lassen sich allgemeine Bestimmungen nicht geben. Erfüllung des Prinzips ist eine notwendige Vorbedingung der ästhetischen Wirkung. Nur wo Einheit und Abstufung herrschen, kommt es zum ästhetischen Totaleindruck, zu mannigfacher Gliederung, zu übersichtlichem Aufbau.
Die innere Beziehung, die das Ganze eines ästhetischen Eindrucks beherrscht, ist eine Zusammengehörigkeit seiner Teile untereinander und mit dem Ganzen. Innerhalb des direkten Faktors hat diese Zusammengehörigkeit den Charakter einer Ähnlichkeit, Nachbarschaft und Regelmäßigkeit, sie ist äußerer Zusammenhang. Innerhalb des relativen Faktors ist sie inneres Bezogensein der Vorstellungen und Gedanken, der Absichten und Handlungen, der eingeführten Zustände und Fähigkeiten aufeinander, ein innerer Zusammenhang. Innerhalb des Miterlebens und der Teilnahme ist sie selbstverständliche Gesetzmäßigkeit und Abgeschlossenheit des Ablaufs, ein zuständlicher Zusammenhang. Innerhalb des Ganzen ist sie wechselseitige Bedingtheit und Ergänzung aller Faktoren durch einander, ein totaler Zusammenhang. Merkliche Verletzungen dieses Prinzips sind mißfällig, besonders wenn sie das Hauptinteresse betreffen, doch werden nicht selten (namentlich bei der Kombination verschiedener Formen der Wirkung) Kompromisse nötig. Beim Mangel an solcher Zusammengehörigkeit spricht die Kritik gern von ästhetischen Widersprüchen.
Regelmäßigkeit und Symmetrie, diese Formen der äußeren Zusammengehörigkeit, herrschen in der Architektur, der Musik und den dekorativen Künsten vor, wo die mittelbare Wirkung zurücktritt. Stimmungszusammenhänge, innere Übergänge meistert etwa Raffaels Kreuztragung, wo die Nächststehenden am lebhaftesten bewegt erscheinen. Die Abgeschlossenheit des Miterlebens fehlt in Hauptmanns Kollege Crampton, wo die Zuschauer gelegentlich sitzen bleiben und nicht begreifen, daß nun die Aufführung zu Ende ist. Sehen wir einen kraftlosen Körper schwere Lasten heben, wird ein schlichtes Märchen mit Nibelungen-Musik untermalt, so ist der totale Zusammenhang gestört. Die einzelnen Zusammenhänge müssen aufeinander abgestimmt sein. Unserem Verständnis müssen sie sich erschließen; sonst ist der innere Zusammenhang eines Werkes oft unerfaßbar. Wer nie die Sage von Danae vernommen hat, würde Correggios Gemälde unverständlich finden. Die gesamte Erfahrung unseres geistigen Lebens bestimmt die ästhetische Wirkung mit. Was sich ihrem Zusammenhang nicht fügt, nennen wir leicht unnatürlich; wir vermissen am Kunstwerk dann die äußere oder innere Wahrheit. Die Taten eines dramatischen Helden müssen uns bei einem solchen Charakter verständlich, unter den gegebenen Umständen als notwendig erscheinen. Gegen die äußere Wahrheit versündigen sich Bilder von Gebhardt, auf denen biblische Gestalten in Renaissance-Gewändern erscheinen. Shakespeares Anachronismen laufen ihr zuwider. Die Formen der Zusammengehörigkeit können auch zu langweiligen Manierismen übertrieben werden. Wie steif wirkt ein Gemälde von allzupeinlicher Symmetrie, vom Metronom beherrschte Musik. Verbinden sich Kunstarten zu einem Gesamtkunstwerk, so sind Kompromisse unvermeidlich. Die dramatische Handlung schreitet beschwingter fort als die Oper, weil die Musik ihres Stils mehr Zeit gebraucht, um ihren Stimmungsreichtum zu entfalten. Wer unmusikalisch ist und sich den Tristan Wagners als Drama ansieht, wird das Tempo des Werkes endlos schleppend finden. Der aus-
drucksvolle Stil Michelangelos wird dem relativen Faktor zuliebe manche äußere Regelmäßigkeit opfern, Raffael mäßigt die Fülle des Ausdrucks um der äußeren Formschönheit willen gelegentlich. Immer aber verlangt das überwiegende Hauptinteresse vor allem Berücksichtigung, sei es durch äußere Bindung, sei es durch überzeugende innere Wahrheit.
Das Prinzip der Klarheit besagt, daß die ästhetische Wirkung belebt wird, wenn die hervorbringenden Faktoren in voller Klarheit gegeben sind. Um die Klarheit zu steigern, dienen der Kunst die Mittel des Kontrasts und der (motivischen) Wiederholung. Da die ästhetische Anordnung der Teile in der Natur nur als ein verhältnismäßig seltener Sonderfall enthalten ist, so entsteht für die Kunst die Notwendigkeit, durch steigernde Mittel den Aufbau des ganzen Werkes, seine Interessenabstufung und seinen Zusammenhang klarer herauszuarbeiten. Der Kontrast vergrößert hierbei die Unterscheidbarkeit der Faktoren und hebt sie deutlich voneinander ab, während die Wiederholung das Hauptinteresse eindringlich und einpräglich unterstreicht. Geheimnisse undurchdringlicher Art schädigen die Wirkung des Kunstwerks, weil dann Deutung und Auffassung schwanken. Unübersichtliche Anordnung von Formen und Farben erreichen keine unmittelbare ästhetische Wirkung. Was hilft es, wenn eine Berechnung erst die Formel der Anordnung entdeckt. Beim ästhetischen Genuß an der Natur muß Auswahl, Ausschnitt, Aufmerksamkeit hervorheben und betonen, was der Künstler technisch mit sanftem Zwang uns aufdringt. Farbige Naturphotogramme zeigen erst, wie sehr die Auslese eines künstlerisch geschulten Blicks der Wirklichkeit eine ungewöhnliche Geschlossenheit, befriedigenden Aufbau schenkt und so unsere Teilnahme steigert. Wieviel geschlossener und eindringlicher wirkt dennoch im Vergleich zum feinsinnigsten Lichtbild ein großes Naturgemälde Ruysdaels.
Damit ist der eigentümliche Wert des ästhetischen Naturausdrucks nicht bestritten. Er haftet an Eindrücken, die etwa der Malerei nicht zu Gebote stehen. Man denke nur an die überwältigende Lichtfülle, die satten Farben, die Zartheit des lebendigen Wesens, die Miterregung durch die niederen Sinne. („Die Erde dampft erquickenden Geruch.“) Man würde das Prinzip der Klarheit völlig verkennen, wenn man es im Sinne harter Umrisse, trockener Eindeutigkeit, mikroskopischer Bildschärfe deuten wollte. Es verbannt nicht das sfumato Lionardos, noch die Dämmerung des Helldunkels, weder unentschiedene Lebenslagen, noch fragwürdige Naturen. Die seltsame Lebhaftigkeit der Phantasie in dämmernder Nacht, die eine traumhafte Umgebung aus der Landschaft webt, würde erlöschen, wollten wir die Tagesklarheit hineinleuchten lassen. Nein, die Unklarheit des Gegenstandes ist nicht die Unerfaßbarkeit eines entscheidenden ästhetischen Eindrucks; nur diese Ungreifbarkeit muß befremden, verwirren und enttäuschen. Die verschwommene Form übt ihren ästhetischen Zauber, wenn nur der Zusammenhang der Interessenabstufung sich auswirkt. Da nun Klarheit des Aufbaus in der natürlichen Ordnung der Dinge nur zufällig gegeben ist, so bedarf auch die naturalistische Kunst einer Auswahl und einer Ausscheidung. Zeichnen ist auch nach Liebermann eine Kunst fortzulassen. Alle Kunst, auch der Naturalismus, stilisiert.
Der Kontrast ist ein Hauptmittel, die Eigenart eines bestimmten Eindrucks zu steigern. In heiterer Umgebung fällt uns ein Trauriger erst recht auf, in gleichmäßiger Helligkeit ein tiefer Schatten, starre Ruhe in aufgeregter Bewegung. Es steigert der Musiker die versöhnende Harmonie des Abschlusses durch Dissonanzen vor der Auflösung, der Maler die tiefen und satten Farben des Vordergrundes durch die blassen und verschwimmenden im Hintergrunde. Potter legt seinen sehnsüchtig mit schweifendem Blick die Weite suchenden Wolfshund an die kurze Kette. Im Drama steht die Hauptgestalt verschiedenen Nebenpersonen gegenüber, die
durch ihr kontrastierendes Gebaren das Schicksal des Helden um so klarer beleuchten (Maria Stuart – Elisabeth von England).
Ein weiteres Mittel der Steigerung ist die Wiederholung. Man denke an Wagners Leitmotiv, die Wiederkehr ornamentaler Verschlingungen, den Parallelismus der hebräischen Dichtung. Böcklin vertieft den Eindruck seiner Landschaftsstimmung durch sagenhafte Märchenwesen, die von ihrer Atmosphäre befangen sind. Die Malerei läßt vielfach die Landschaft mit den Fröhlichen lachen, mit der Büßerin trauern.
Fechner hat das Prinzip der Klarheit als eines seiner drei obersten Formalprinzipien bezeichnet. Es kann nach ihm vorkommen, daß wir Gefallen an der Klarheit finden, während zugleich Mißfälligkeit aus anderen Prinzipien spürbar wird. Hier wird ästhetische Klarheit mit logischer oder auch mit objektiver verwechselt. Das ist Freude an der Erleichterung der Auffassung, an gelingender Kontemplation, also nur Aktionslust. Das ästhetische Gefallen wird durch Klarheit nur gesteigert, wenn es sonst schon durch Art und Aufbau des Gegenstandes gefördert wird. Was Fechner meint, ist zunächst gar keine ästhetische, sondern eine intellektuelle Freude, die freilich auch in das ästhetische Verhalten eingehen kann und damit zu ästhetischer Freude wird. Auch vom Prinzip der Steigerung redet Fechner in ganz anderem Sinne, nämlich mit Rücksicht auf die Steigerung des ästhetischen Gefühls. Dagegen hat er ein besonderes Prinzip des Kontrastes. Dieser ist jedoch nur ein Mittel zur Steigerung der ästhetischen Klarheit.
Von einer Fülle des ästhetischen Eindrucks redet man zunächst im Sinne der Vollständigkeit und Abgeschlossenheit, welche die gefällige Wirkung der Zusammengehörigkeit steigert, sodann im Sinne mannigfaltigen Reichtums, wodurch das Interesse extensiv stärker gefesselt wird. Tiefe spricht
man dem Gegenstande zu, wenn er geeignet ist, ein intensives und nachhaltiges, in Einfühlung und Teilnahme vollentfaltetes ästhetisches Verhalten anzuregen. Die Erfüllung auch dieses Prinzips steigert den Grad der ästhetischen Wirkung. Formale Fülle weisen Gemälde, die nicht auf eine ärmliche Farbenskala beschränkt sind, Ornamente, die den verfügbaren Raum ohne tote Stellen in reicher Durchbildung schmücken. Die musikalische Harmonie füllt die Leere von Oktaven- und Quintengängen, die uns hohl und einförmig anmuten. Duette a capella erscheinen uns besonders bei enger Stimmführung unvollständig, ergänzungsbedürftig. Im inneren Zusammenhange bedeutet das Verlangen nach Fülle, daß nichts Wesentliches im Gedanken- und Vorstellungsverlauf übergangen werde. Vom Träger des Hauptinteresses im Epos wünschen wir zu erfahren, was sein Tun entscheidend motiviert.
Zu dieser Extensität der ästhetischen Wirkung gesellt das Prinzip die Intensität, zur Fülle die Tiefe. Das Interesse soll hiernach nicht nur einheitlich, sondern auch tiefgehend sein. Die Tiefe der ästhetischen Wirkung ermessen wir namentlich an der Einfühlung und Teilnahme. Je stärker wir am ästhetischen Verhalten beteiligt sind, um so tiefer ist die ästhetische Wirkung. Besonders wird sympathische Einfühlung sich nur da entfalten, wo eine tiefe ästhetische Wirkung stattfindet. Diese Tiefe ist auch an lebhafte Fesselung des Interesses gebunden. Dazu sind nicht etwa nur neue und unerhörte Eindrücke nötig, gerade die vertrauten immer wiederkehrenden, nie ganz gelösten Fragen des Herzens, die ewig menschlichen Schicksale rühren uns in der Tiefe und versagen nicht: Macht, Liebe, Ehrfurcht, Gewalt der Eltern, die heiligen Dinge sind Namen, die unser Denken und Fühlen ergreifen und erschüttern. Kein Kunstwerk veraltet leichter als Werke, die auf das Tagesinteresse aufgebaut sind. Satire und Tendenz können augenblicks kräftig wirken. Flugs sind sie gegenstandslos geworden, und sie büßen ihre tiefe ästhetische Wirkung völlig ein, wenn ihr
Wert nicht auf anderen Qualitäten beruht; wie etwa in Kabale und Liebe, Nora, und in Hebbels Maria Magdalena. A priori lassen sich die Gegenstände, die tiefe Wirkung üben, nicht angeben. Die Fülle ist groß. Man hat oft von klassischen Kunstwerken gesagt, sie seien unerschöpflich, da sie eine Tiefe des Gehalts aufweisen, die sie allerorten und allzeit ergreifend macht. Wenn irgendwo gilt hier Kants Wort, daß der Künstler das Gesetz und nicht das Gesetz den Künstler macht. Es gibt keine Vorschrift, wie man tiefe Kunstwerke herstellt. Man versteht es, wenn vom Künstler gesagt werden kann, er müsse ganz Mensch sein. So wird das Werk zur Ausströmung des ganzen Menschen und damit fähig, den ganzen Menschen zu ergreifen. An sich gibt es ja kaum einen, dem allgemeinen Verständnis zugänglichen Gegenstand, der sich nicht in fesselnder Form darstellen ließe und so tiefgehend zu wirken vermöchte. Man denke nur an Vischers „Auch Einer“. Das Problem von der Tücke des Objekts, dem Widerstand des Schicksals gerade in den kleinlichen Alltäglichkeiten des Lebens, hat Vischer zum ersten Male geistreich behandelt; er hat verstanden, dem Stoff ein tragisches Motiv abzugewinnen und ihm tiefe Wirkung zu sichern.
Nach dem Prinzip der Einfachheit und Natürlichkeit wird die schlichte Formgebung der verkünstelten vorgezogen. Was mit wenigen Mitteln tiefe Wirkung sichert, erscheint wertvoller als ein mit tausend Mittelchen herausgeputzter Aufbau. Zwanglos gewachsenes und gewordenes Werk steht uns über der absichtlich gemachten, unter Regelzwang erquälten Arbeit. Einfachheit ist darum noch nicht Dürftigkeit. Die ältere Naturphilosophie kannte eine lex parsimoniae; sie war der Ansicht, daß die Natur alle Wirkungen mit den einfachsten Mitteln erreiche. Mindestens erscheint uns die ästhetische Wirkung der Natur da überwältigend, wo sie sich diesem Gesetz zu beugen scheint. Nicht gerade
einfach kann man es nennen, wenn die Programmusik versucht, die Wirkung der Musik durch einen fortlaufenden Kommentar zu steigern. Man darf dies Programm nicht mit Erläuterungen vergleichen, die einer Einführung in die bildende Kunst dienen. Solche Erläuterungen geben nur ein Wissen von Namen, ersonnenen oder geschichtlichen Ereignissen. Man erinnert angesichts der Laokoongruppe an Vergils epische Schilderung, man weiß nun, ob Laokoon Priamide war. Das ästhetische Verständnis erschließt uns auch ohne Erläuterung die dämonische Gewalt der Schlangen, die unheilvolle Verschlingung. Der Musik aber quält das Programm künstlich eine Bestimmtheit des Ausdrucks an, die ihr wesentlich mangelt und lenkt von der Hingabe an die musikalische Leistung ab. Das Verständnisurteil, eine Vorbedingung der ästhetischen Wirkung, wird zur Hauptsache gemacht. Die Musik ist nun einmal nicht dazu berufen, Geschichten zu erzählen. Deshalb ist Programmusik unnatürlich. Lessing sah sich im 18. Jahrhundert noch genötigt, dem unnatürlichen Unfug der Lehre ut pictura poesis ein Ende zu bereiten. Heute wäre es dringend not, daß ein neuer Lessing zwischen Dichtung und Tonkunst die Grenzen betone. Unnatürlich und keineswegs einfach sind Romane, wo die gangbaren Wege psychologischer Motivierung verlassen werden zugunsten erkünstelter überhitzter Konflikte.
Schon in dem Ausdruck Natürlichkeit liegt ein Hinweis auf die Natur als Vorbild. Damit ist nicht die graue Alltagswirklichkeit zu sklavischer Nachahmung empfohlen. Vielmehr soll uns der ästhetische Eindruck, auch der phantasieentstammte, erscheinen, als ob er blühende reiche Wirklichkeit wäre, keine Fiktion, kein wüster Einfall. Gerade die Stilisierung macht aus ihrem Werk eine kleine in sich lebende Wclt. Solcher Art ist die Wirklichkeit und Wahrscheinlichkeit, die uns an einer Dichtung erfreut. Der Naturalismus stützt sich einseitig auf das Prinzip der Natürlichkeit, die Bedürfnisse seiner Stilgebung für die einzig erfüllenswerten ausgebend. Dabei erweiterte er aber den Kreis der dem
Künstler erschließbaren Erfahrung. So gewinnt der Impressionismus, das plein-air seine ästhetische Legitimation. Aber deswegen sind Mythos, Phantasma, Gespenster, Kentauren und Kobolde, Magier und Hexen nicht unnatürlich im Sinne der Ästhetik. Das Ungewöhnliche wirkt natürlich, wenn es vollauf motiviert ist.
Unnatürlich wirkt auch ein schöner Mensch, der bewußt gefallen will. Ebenso stößt eine merkliche Absicht im Kunstwerk ab. Merklich aber wird die Absicht durch Übertreibung des Kontrastes, der Wiederholung und sonstiger Kunstmittel. Die Tendenz läßt einen ästhetischen Gesamteindruck nicht aufkommen, lenkt auf außerästhetische Interessen ab, will uns belehren, unsere Teilnahme beeinflussen, unser Urteil leiten. Der Künstler soll uns nicht das selbständige Urteil vorwegnehmen und soll uns nicht belehren; das Werk soll durch sein Dasein, nicht durch seines Meisters Absicht gefallen.
Das Prinzip der Wertausgleichung erinnert daran, daß aus den Einzelbewertungen der Form, des Gehalts, der Einheit, des Zusammenhangs, der Geschlossenheit, der Fülle, der Tiefe und der Natürlichkeit, eine Gesamtbewertung resultiert, die jede stilistisch begründete Wertminderung eines Faktors zugunsten eines anderen ausgleicht, und nimmt das Gesetz der Wertübertragung in sich auf, laut dem alle den ästhetischen Gegenständen anhaftenden logischen, ethischen, vitalen und metaphysischen Werte in die ästhetische Wirkung mit eingehen. Auf diese Weise kann auch ein Ganzes gefällig werden, obwohl nur ein Teil ausgeprägte Wirkungen dieser Art übt. Wenn man den Vorwurf erhebt, das Kind sei mit dem Bade ausgeschüttet worden, so meint man eine Mißachtung des Prinzips der Wertausgleichung. An eine Nebensache heftet sich das Mißfallen, eine Auflösung der kleinen Disharmonie wird gar nicht versucht.
Fechner hat versucht, die Wertausgleichung genauer
zu formulieren, indem er ein Prinzip des Kontrastes aufstellt, wonach der angenehme Eindruck den unangenehmen steigern soll und umgekehrt. Doch läßt sich das in dieser Allgemeinheit nicht bestätigen. Welche Werte hier mitwirken und mit welcher Kraft sie einwirken, läßt sich allgemein nicht bestimmen. Es gibt keinen Wert, der nicht ins ästhetische Verhalten eingehen könnte.
Die Anwendung des Prinzips der Wertübertragung auf die anderen ästhetischen Prinzipien ist verständlich. Die Prinzipien der Fülle und der Tiefe, der Einheit und der Mannigfaltigkeit, der äußere und der innere Zusammenhang, sie beschränken sich wechselseitig. Kein einziges ästhetisches Prinzip kommt für sich allein zur vollen Geltung. Die verschieden einflußreiche Wirkung der ästhetischen Komponenten gleicht sich in der Gesamtwirkung des schönen Werkes aller Stilarten immer wieder aus. Der Freiheit des Künstlers wie des Kunstfreundes in der Wahl seiner Ausdrucksmittel, Stoffe und Formen geschieht also durch die Prinzipien der Ästhetik kein Eintrag. Die ästhetische Beurteilung kann sich nur auf Kriterien stützen, die den gesetzmäßigen Wirkungen eines reinen, intensiven und vollständigen ästhetischen Verhaltens entspringen.
Als besondere Modifikationen des ästhetischen Eindrucks nennen wir, was schön, erhaben, anmutig, tragisch oder komisch wirkt. Gefallen und Mißfallen werden hier durch die besondere Beschaffenheit der ästhetischen Gegenstände und der an sie geknüpften Objektsgefühle eigenartige Färbung gewinnen. Schönheit und Häßlichkeit sind die primären ästhetischen Modifikationen aller Träger der bisher geschilderten ästhetischen Wirkungen (abgesehen von Besonderheiten gegenständlicher Art und einer ihnen entsprechenden Gemütswirkung) unter der Vorherrschaft eines kontemplativen Zustandes und eines ästhetisch gerichteten Interesses. Zu den sekundären Formen des ästhetischen Eindrucks rech-
nen wir die Modifikationen, bei denen Objektsgefühle sich an umfassende und zugleich eindringliche Beschaffenheiten des ästhetischen Gegenstandes knüpfen. Die ästhetischen Modifikationen sind nicht auf einzelne Kunstarten beschränkt; Malerei, Musik, Epos, Lyrik, Drama gehören also nicht hierher. In den Modifikationen erfährt der ästhetische Eindruck selbst, erfahren Gefallen und Mißfallen eine eigentümliche Färbung. Diese kann niemals durch qualitativ charakteristische Eigenschaften des ästhetischen Gegenstandes allein, sondern nur durch Gemütsbewegungen, Stimmungen und Affekte entstehen, die an jene Eigenschaften gleichförmig gebunden sind. Die Objektsgefühle sind allein geeignet, so tiefgreifende und allgemein wirksame Unterschiede zu begründen. So wenig wie wir mit der Formalästhetik den stofflichen Gehalt des Kunstwerks aus der Betrachtung ausschalten können, so wenig können wir bei der genaueren Erforschung des ästhetischen Eindrucks von den Objektgefühlen absehen. Wenn man nun bedenkt, daß Interesse eine conditio sine qua non des ästhetischen Eindrucks und insbesondere der Objektgefühle ist, so wird es naheliegen, die sekundären ästhetischen Modifikationen einzuteilen nach dem, was allgemein am ästhetischen Objekt interessiert. Die Quantität fesselt das Interesse, wenn sie ungewöhnlich ist, extensiv oder intensiv. Ferner lenkt die Veränderung überall die Aufmerksamkeit auf sich; schließlich wird die Gefühlsrichtung auf Trauer oder Heiterkeit allgemein wichtig. Modifikationen der Quantität sind Erhabenheit und Niedlichkeit, Modifikationen der Veränderung Anmut und Plumpheit, Modifikationen der Trauer und Heiterkeit sind Tragik und Komik. Die von den ästhetischen Modifikationen geweckten Objektgefühle der Erhebung, Rührung, Trauer stören die kontemplative Versenkung nirgends, im Gegenteil, sie vertiefen und läutern sie. Nicht gemeint ist das kindische Gebaren lauten Klagens über das Los der Romanhelden, oder der Versuch, den tragischen Gestalten der Bühne hilfreich beizuspringen. Solche Manifestation der Ergriffenheit zerstört das ästhetische Ver-
halten, derartige ungehemmte Gefühlsreaktionen sind nicht Forschungsgegenstand der Ästhetik. Damit wird nicht die Theorie aufgestellt, daß die von den ästhetischen Modifikationen ausgelösten Stimmungen schwächer oder scheinhafter seien, als das echte hemmungslos sich entladende Gefühl. Wenn die Aktion ausgeschaltet wird, kann das miterlebende Gefühl um so inniger gekostet werden. Die Objektsgefühle also sind imstande, den ästhetischen Eindrücken eine eigene Stimmungsfärbung aufzuprägen. Das Gefallen am Erhabenen, am Tragischen, am Komischen ist immer auf den Grundton der vollen unbefangenen ästhetischen Lust abgestimmt, aber dieser Grundton wird (wie ein Klang möchte man fast sagen) verfärbt durch die Stimmungslage der Objektgefühle. Darum redet man ganz treffend vom Gefühl für das Schöne, aber von tragischer oder erhabener Stimmung.
Nun darf man nicht vergessen, daß unser Wertgefühl auf die von Objektgefühlen verfärbten ästhetischen Modifikationen immer zwiefach, nämlich mit Gefallen und Mißfallen reagieren kann. Auf erfreuliche Objektsgefühle kann gleichsinnig ästhetisches Gefallen antworten, auf unerfreuliche Objektsgefühle gleichsinnig Mißfallen; aber ein Tugendbold kann auch gegensinnig ästhetisches Mißfallen wachrufen, wo ein Heiliger derselben Tugend reines Gefallen fände. Die Satire des Wertlosen kann gegensinnig ästhetisch erfreuen. Wir unterscheiden also gleichsinnig und gegensinnig wirkende ästhetische Modifikationen. Was ungeheuer und wertvoll Gefallen weckt, ist von einer feierlichen Erhabenheit. Bizarr wird diese werte Größe, wenn sie ästhetisch mißfällt (der alte Bayard). Mißfällt was ungeheuer ist und unwert, so wirkt es abscheulich, erzwingt es aber ästhetische Freude, dann wirkt es furchtbar. Was winzig und doch wert ist, gefällt als zierlich, mißfällt als kleinliche Spielerei. Unwertes und winziges Werk mißfällt als Nichtigkeit, als niedlich, launig gefällt es (chinoiserie). Eine anmutige Gebärde gefällt als hold, als kokett mißfällt sie. Als steif und würdig kann sie doch noch Anmut heißen und gefallen (an
alten Damen aus edelm Blut etwa). Die äußere Plumpheit, ein Widerspiel der Anmut, mißfällt als linkisch und gefällt als grottesk. Wert im Leiden erwirbt tragisches Gefallen, mißfällt sein Leiden, dann ist es empörend. Der traurige Untergang des Unwerten schafft Grausen, gräßlich aber ist solches Leiden, wenn es nicht mehr das leiseste ästhetische Gefallen für sich hat. Schafft die Komik heitere Werte, so ist sie humoristisch, lacht sie über den Unwert, so wird sie satirisch; und gefällt beide Male. Geißelt sie mißfallenden Unwert, so wird sie gar sarkastisch bis zynisch; mangelt ihr das ästhetische Gelingen, so ist sie sofort auch läppisch, abgeschmackt, salzlos.
Auf Mischformen hier einzugehen, würde zu weit führen; daß individuelle Unterschiede in der Empfänglichkeit für die ästhetischen Modifikationen mitwalten, braucht gleichfalls nicht mehr ausgeführt zu werden. Die ästhetische Modifikation entfaltet sich nach alledem unbeschadet der individuellen Differenzen im vollen ästhetischen Eindruck an schöner Natur und an schöner Kunst trotz mannigfacher Häßlichkeitsdissonanz. Merklich hervorbrechende Objektgefühle werden dabei durch eindringliche und fesselnde Beschaffenheiten des ästhetischen Gegenstandes erregt. Die ästhetische Wirkung feiert ihren größten Triumph, wenn ästhetisches Gefallen über sonstigen Unwert siegt. Groß ist ein geborener Tragiker, der schließlich auch ein Leuchten des Humors in seltenem Lächeln einfängt.
Anmut ist als Schönheit maßvoll bewegter Form die Gebärde liebenswürdiger Leichtigkeit und erfreulich beherrschter sympathischer Kraft. Plump ist ruckhaft bewegte Mißform als Ausdruck gezwungener Unbeholfenheit und abstoßend gesetzloser Kraft. Seelenlose Anmut, die leere Maske der liebenswürdigen Herzlichkeit, kann auch ästhetisch nicht gefallen, anders als herbe Anmut, die, verhalten, sich nur nicht freigemut ausströmt. Schiller und v. Hartmann fassen
Anmut als Gegensatz des Erhabenen. Horne nimmt sie als ausschließliches Attribut des Menschen, als Ausdruck der schönen Seele. Lessing definiert sie als Schönheit der Bewegung. Schiller findet Anmut in sympathetischen Bewegungen, welche die willkürlichen als Ausdruck der unbewußt mitanklingenden Empfindung unwillkürlich begleiten. Indem diese Bewegungen endlich habituell werden, bilden sie feste Züge. Volkelt findet im Anmutigen ein vollendetes Gleichgewicht zwischen Natur und Geist, wie nirgend sonst. Zu eng ist die Auffassung, wonach nur der Mensch und seine Bewegungen anmutig heißen dürfen. Auch das Tier (ein Reh) kann anmutig sein, aber auch Pflanzen (Kletterrose), die Linien einer Hügellandschaft, die Windungen eines Flußtales, ein Allegretto grazioso. Anmut wird sich bei Menschen nur da entfalten, wo Intention und Ausführung, Kraft und Aktion mühelos zusammenstimmen. So erscheint die freie, leichte und ungezwungen verlaufende Gebärde als freundliche Naturgabe. Nur Animismus, nicht Anthropomorphismus ist Voraussetzung, um die Heiterkeit aller Anmut auch bei Tier und Pflanze zu finden, ja fast überall da, wo wir Bewegung im übertragenen Sinne meinen. Wir zollen der Anmut deshalb nicht jene intensive Bewunderung, die uns zur Demut stimmt wie die Erhabenheit, sie erfreut dafür fast unvermerkt und herzlich. Das milde und sanfte Leuchten der lieblichen Gebärde reizt zu vertrauter Teilnahme, der fernen Unerreichbarkeit des Erhabenen beugen wir uns. Das sinnliche, nicht das sittliche Ideal ist uns Anmut. Ihr zartes, heiteres, sinniges Wesen, von Feierlichkeit und würdigem Ernst ebenso wie von ausgelassenem Übermut und Zügellosigkeit gleichweit entfernt, entfacht die echte Stimmung der Geselligkeit im edeln Sinne des Wortes.
Anmut erscheint in mannigfachen Spielarten ausgeprägt. Eine ihrer Formen ist die hohe Anmut; hier zeugt ihre edle Gebärde von echtem Gehalt vornehmen Wertes. Volkelt glaubt zu spüren, wie sich darin der Geist leise zum Natürlichen hinabneigt. Botticelli, Raffael, Correggio sind Maler
der hohen Anmut. Die holde Anmut schwebt nach Volkelt im Gleichgewicht zwischen Geist und Natur, ihr eignet volle Harmonie. Die liebliche Anmut ist vielleicht an Gehalt etwas ärmer; ihre Dichter sind Theokrit, Eichendorff. Die derbe Anmut spielt aus Unwert des Gehalts ins Bäurische, das Plumpe im Gebaren ist da noch eben gebändigt. Wir begegnen ihr auch bei Rubens und Dürer. Volkelt unterscheidet noch weiche und herbe Anmut. Die weiche Anmut hat Züge der Kraftlosigkeit und Hingebung. Guido Reni ist ihr Maler. Über die Eigenart herber Anmut sprachen wir schon. Wenn wir mit Volkelt von zierlicher Anmut reden, machen wir schon den Übergang zu einer anderen ästhetischen Modifikation. Auch der Frohsinn der Anmut hat seine Abschattungen von der ernsten bis zur lachenden Anmut. Nicht nur in der Spielart derber Anmut kann Plumpheit ästhetisch wertvoll werden, wo sie als Nebenmoment von der anmutigen Form überwältigt wird, im belustigenden Gegensatz, als Burleske, kann plumper Mangel der Anmut mit komischer Wirkung packen.
Menschen von heiterer, liebenswürdiger, geselliger Gemütsart zeigen individuelle Vorliebe für das Anmutige und seine Göttinnen, die Grazien, Nymphen und Elfen. Maler der Anmut sind Andrea del Sarto, Watteau; Musiker der Anmut Mozart, Rossini. Der anmutige Tanz ist das Menuett; seine Gesellschaft des Rokoko lebt im Zeitalter der Anmut.
Was im ursprünglichen und im übertragenen Sinne ungemein groß und kraftvoll wirkt, erregt in uns die Stimmung der Achtung, Verehrung und Bewunderung, wenn Größe und Kraft von einem Wert ausstrahlen, Grauen und Furcht aber, wenn sie einen Unwert umkleiden. Was aber ungemein schwach und klein oder winzig ist, stimmt zu freundlich wohlwollender Teilnahme oder spielender Herablassung, wenn es noch Wert hat, zu mißachtender Geringschätzung, wenn Wert ihm mangelt. Gefallende Größe ist erhaben, miß-
fallende abscheulich. Gefällt Größe am Unwert ästhetisch, so ergreift uns Grauen; ja es kann etwas grauenhaft oder furchtbar schön sein, wie die nächtliche Feuersbrunst. Winzigkeit mit Schönheit gepaart wirkt niedlich fein, Anmut und Kleinheit zierlich, häßliche Winzigkeit aber ist reizlos nichtig. Kant läßt die Erhabenheit vorwalten, wo ehrfurchtgebietende Vernunftgröße die gefallende Sinnenschönheit überwältigt. Schopenhauer hat in der Erhebung des Intellekts über den Willen den eigentlichen Grund der Erhabenheit gefunden. Hegel erschaut darin ein überwiegen der Idee über die Erscheinung. Köstlin faßt das Erhabene als das unermeßlich Bedeutende und stellt ihm das Winzige und Nichtige gegenüber. Gemeinsam ist allen Bestimmungen über das Erhabene, daß man es im ungemein Großen, im bedeutenden überragen sucht. Unendlich, gewaltig, übermächtig wird genannt, was aus der Stimmung ehrfürchtiger Bewunderung mittelbar oder unmittelbar die Objektgefühle weckt, die wir im ästhetischen Eindruck als Modifikation der Erhabenheit wiederfinden. Dem, der von Größe und Kraft im objektiven Sinne redet, wendet Volkelt ein, daß es darauf ankomme, ob man sie einfühle. Daran ist richtig, daß die Begriffe von Kraft und Größe relativ sind. Wenn wir vom ungemein Großen sprechen, so messen wir nicht mehr an einem objektiven Maßstabe, sondern meinen, was schlechthin gewaltig erscheint; von Eindrücken ist die Rede, die einfühlenden Menschen außer der Massen ungewöhnlich sind. Aber darüber darf man nicht vergessen, daß die objektive Beschaffenheit geeignet sein muß, derartige Eigenschaften zu tragen. Ein schweigender und düsterer Hochwald wird nur auf eine fühlende Seele erhaben wirken; aber es ist doch Hochwald, in seiner Art von ungemeiner Größe. Es ist ferner zwischen dem erhabenen Eindruck einer Erscheinung und der Wirkung ihres innerlichen Wesens zu scheiden. Ein Zwerg kann auf Grund seines Charakters erhaben sein, niemals in seiner äußeren Erscheinung. Um den Eindruck ungewöhnlicher Quantität oder Intensität hervorzurufen, können alle Auffassungsein-
flüsse mitwirken: Empfänglichkeit, Kontrast mit dem Kleinen, Undeutlichkeit verschwimmender Grenzen. Die Stimmung, in die wir angesichts des Ungeheuren geraten, ist zunächst Staunen. Wir fühlen uns getroffen von einem ungewöhnlichen Eindruck, sind überrascht, verwundert und gefesselt, ganz Auge und Ohr. Das Staunen aber differenziert sich, je nachdem Wert oder Unwert so ungeheuer wirkt. Auch sinnlichen Vorzügen, überwältigender Leibeskraft zollen wir eine gewisse Achtung und Bewunderung. Man denke an das Ideal der nordischen Riesen oder des Herakles. Das eigentliche Gebiet solcher sinnlichen Größe und Kraft ist die Natur mit dem weiten Meer, dem stürmischen Alpengewitter. Zum Unwert wird die zerstörende Natur in Lawinen, Orkanen, im Erdbeben, und weckt die Stimmung des Grauens und der Furcht. Achtung und Bewunderung, Furcht und Grauen sind nicht Gefühle des Miterlebens, sondern Teilnahmegefühle. Sympathische Einfühlung steigert unser Selbstgefühl nur da zur Erhebung, wo uns der erhabene Wert als Ideal erscheint. Zur Achtung, zur Bewunderung gehört keinesfalls, daß man sich selbst klein fühlt. Achtung ist eine Stimmung, in der das Lustgefühl mehr oder weniger durch Ernst gedämpft ist. Ein Vergleich der Sache, in die man sich in ästhetischer Kontemplation versenkt, mit uns selbst oder mit anderen, schädigt höchstens das empfängliche Verhalten. Eben deshalb sagt man mit Recht von erhabenen Werken, sie seien unvergleichlich groß, ohne allen Vergleich bedeutend. Beim Anblick des Unwertes dagegen ist die Beziehung auf leidende Wesen kaum auszuschalten. Über dem Grauen vor der wütenden Feuersbrunst wird das Menschenleid nicht vergessen. Im übertragenen Sinn kann Charakterstärke, Bosheit, Leichtsinn, Edelmut, Schwärmerei ungeheuer genannt werden. Auch hier sind intellektuelle, sittliche, religiöse Werte und Unwerte zu unterscheiden. Hier können wir die ganze Reihe der Stimmungen von der Verehrung bis zur Verachtung durchlaufen. Bei deren großer Verschiedenheit entstehen mannigfache Färbungen des ästhetischen Eindrucks. Sittliche
Größe, Opferwilligkeit, Reinheit, Wahrhaftigkeit erhebt, Naturgewalten erschüttern, räumliche und zeitliche Unermeßlichkeit, der Anblick des gestirnten Himmels weitet und beruhigt. Breitet sich über die schweigende Gebirgswelt wolkenloser Tageshimmel, so erfüllt sich unser Gemüt mit jener verklärten Freudigkeit, die von Sorgen und Hast eines kleinen Daseins nichts mehr weiß. Darum reden wir von erhabener Größe, erhabener Stimmung, erhabenem Frieden. Alle diese Stimmungen enthalten nichts von Grauen in sich. Dies tritt erst bei Unwerten ein. Es ist darum einseitig, wenn Burke das Grauenerregende für erhaben erklärt unter der Bedingung, daß wir in Sicherheit seien.
Eindrücke der Erhabenheit werden durch bunte Mannigfaltigkeit gestört. Einfache Gleichförmigkeit ist ihnen wesentlich. Das unabsehbar einförmige Meer, die lebenentrückten Gletscher, das unermeßliche Blau des Himmelsgewölbes, ihnen mangelt die Fülle der anmutigen Schönheit. Darum gewinnen gewaltige Berge und Bauten an Erhabenheit, je mehr Einzelheiten sich in Dämmerung verlieren. Doch ist wesentlich wichtig, daß die großen und strengen Züge die Kleingliederung sicher beherrschen; sie braucht dann nicht zu fehlen, sie kann sogar reich sein, wenn sie nur maßvoll ist, wie Volkelt mit Recht betont. Die erhabene Gestalt als Ganzes kann schöngeformt sein und dadurch an ästhetischem Wert gewinnen. Das Matterhorn wirkt erhaben, die Jungfrau im Berner Oberland ist von erhabener Schönheit. Häßliche Formen mit Erhabenheit gepaart, gehen ins Barocke über. Sofern Sprache und Musik mit der erhabenen Stimmung gesättigt sind, kann ihre Darstellung erhaben heißen, nicht aber, wenn sie versuchen, einen erhabenen Gegenstand zu umschreiben, zu schildern. Das gäbe bestenfalls eine Darstellung des Erhabenen. Nicht nur von erhabener Schönheit zu reden, hat seinen guten Sinn; auch grauenhafte Schönheit verwirklicht sich in Natur und Kunst und entfesselt einen wahren Wettstreit des Gefühls. Grauenhaft sind Shakespeares dritter Richard und Holofernes bei Hebbel, weil hier
das Ungeheure als eine zerstörende und drohende Macht auftritt, grauenhaft ist die Schönheit eines Kraterausbruchs, grauenhaft schön ist die Medusa, ist die rächerische Medea. Scheußlich wird was grauenhaft und häßlich ist, scheußlich ist Hebbels Golo, ist die Wunde Philoktets als Ursache gewaltigen Schmerzes. Es ist verständlich, wie sehr es einen Künstler reizen muß, auch Unwerte ästhetisch zu bewältigen. Dann aber darf erst recht nichts bloß geschilderter Inhalt bleiben, der Unwert muß verformt, bezwungen sein; sonst widert er an. Reicher Schmuck differenziert den erhabenen Eindruck der Größe zu Prunk und Pracht; überwiegt der schlichte Charakter der Erhabenheit den Aufwand an schmückender Schönheit, so verfärbt sich die Erhabenheit zur Feierlichkeit. Ist diese mehr als äußeres Gebaren, so läßt sie die würdevolle Gesinnung durchschimmern. Wagners König Marke ist würdevoll erhaben; majestätisch der Zeus von Otricoli. Religiös durchglutete Erhabenheit ist weihevoll.
Während wir gestimmt sind, uns vor der Erhabenheit zu beugen, flößt uns das Kleine und Winzige herablassendes Wohlwollen ein. Selten ist diese Stimmung ohne einen Beigeschmack natürlicher Überlegenheit an Kraft der Selbsterhaltung. Goliath verachtet den kleinen David; diese physisch-instinktive Wertschätzung wird sich dem Zierlichen gegenüber, ethischen Bedenken entgegen, immer wieder als Gefühlsgrundlage durchsetzen. Es ist immer nur ein Schritt von den zierlichsten Gestalten und Gebärden, von der idyllischen Situation hinüber ins komisch Drollige. Und auch vom Meister der gefälligen Kleinkunst wird immer gelten, was man von der Sängerin Catalani gesagt hat: Elle est grande dans son genre, mais son genre n’est pas grand.
Traurige Ereignisse, wie körperliches und seelisches Leiden, schmerzreicher Kampf und Tod, die lebhafte Objektgefühle und tiefgehende Teilnahme erregen, Ereignisse, in denen Wertvolles untergeht, während sein Wert obsiegt,
wirken für die ästhetische Betrachtung tragisch, wenn sie den Eindruck eines unabwendbaren, mit innerer Notwendigkeit sich entfaltenden Vorganges machen. Wesentlich vertieft wird diese Wirkung durch die (nicht unbedingt erforderliche) Verbindung mit dem Erhabenen, das sowohl in dem ungemeinen Werte der über alles Leid triumphierenden Idee, wie auch in der menschlichen Größe des Dulders (Oidipus, Lear) liegen kann. Den extremen Gegensatz zum Tragischen bildet das Gräßliche, wo traurige Ereignisse blind zufällig Wertvolles vernichten. Empörend ist ein notwendiges Verhängnis, das ohne den reinen Triumph des Wertes zerstört, was wertvoll ist.
Nach Aristoteles waltet Tragik in ernsten großen Ereignissen, die Furcht und Mitleid erregen und von der ursprünglichen Kleinherzigkeit solch leidenschaftlicher Wirrung reinigen. Für Schelling beginnt Tragik, wo höchstes Leid in höchste Leidüberwindung umschlägt, wo die Not des Schicksals vom Willen erhabener Gesinnung überwältigt wird. Nach v. Hartmann steigert sich einseitig leidenschaftliche Begierde zum tragischen Konflikt, der, irdisch unlösbar, durch transzendente Lösung erhabenen Ausgang findet. Lipps betont, wie die tragische Situation den Persönlichkeitswert der tragischen Gestalt fühlend mitzuerleben taugt.
Nur durch ästhetische Kontemplation wird das Traurige tragisch. Deshalb ist Tragik doch nicht auf die Dichtung beschränkt; auch schweres erhabenes Leid in Natur und Geschichte wirkt tragisch, wenn es Wertvolles trifft und den Wert nicht mit in den Untergang reißt. Der Tod des Sokrates, das Leiden Christi und aller Märtyrer kann als tragisch betrachtet werden. Das Leiden der tragischen Gestalt braucht nicht immer Todesnot zu sein; auch seelische Schmerzen, wie sie z. B. über Lear hereinbrechen, können als solche schon tragisches Leid sein. Entscheidend für die tragische Wirkung ist der Eindruck der Unabwendbarkeit. Glauben wir nicht an die Notwendigkeit des tragischen Untergangs, so stößt er uns als entsetzlich ab. Daher entstammen tra-
gische Wirkungen eher der hohen Kunst als der natürlichen Wirklichkeit, im Gegensatz zum Eindruck der Erhabenheit. In der Kunst muß Tragik nach Hebbel wie der Tod als mit dem Leben selbst gesetzt, als unumgänglich auftreten. Diese Motivierung kann ethisch sein, aber sie braucht es nicht zu sein. Die Theorie, als ob Tragik nur möglich ist, wo Schuld ihre Sühne findet, ist einseitig. Die Unumgänglichkeit des tragischen Ausgangs braucht nicht ethische Vergeltung, nicht logische Notwendigkeit zu sein, als psychologisch notwendig muß sie wirken nach einer ungeschriebenen Psychologie der Menschenkenntnis. Schuld ist nur eine Art von Vergangenheitsbelastung, die Leid motivieren kann. Nicht Splitterrichterei darf über die Schuld des tragischen Helden zu Gericht sitzen. Spiel und Gegenspiel müssen von fester Überzeugung eigenen Rechtes getragen sein, und der Zuschauer muß es mit beiden so fühlen. In den Makkabäern lebt Judah in seinem Recht, wenn er sein Volk frei und groß machen will, seinem Volke lebt das Recht heiligen Brauches im Blut; so durchkreuzt dessen Wille wahrhaft tragisch die Pläne seines Heros. So hängt die tragische Kontemplation mit der Welt- und Lebensanschauung, mit Ethik und Metaphysik zusammen. In der Tragik entfaltet die ästhetische Kontemplation ihre höchste Kraft, feiert sie ihren höchsten Triumph. Sie wandelt die tiefe Trauer in ernstes Wohlgefallen. Damit es möglich sei, das Widerspiel zwischen traurigem Objektsgefühl und dem lauteren Reaktionsgefühl zu überwinden, muß die ästhetische Qualität des Kunstwerks überragen. Innerhalb der Tragödie wird sogar das Entsetzliche erträglich, wenn Unwert als Quelle des Elends erscheint, wenn die gräßlich endende Gestalt gerechte Empörung herausfordert. Dagegen läßt die blind zerstörende Macht vernichtender Naturgewalt die versöhnende Vergeltung vermissen, die den entsetzlichen Untergang Cesare Borgias ästhetisch erträglich macht. Ohne den versöhnenden Sieg des Wertes, dessen Held tragisch untergeht, ohne die lösende Vergeltung, die den entsetzlichen Menschen zerbricht, wirkt auch eine
Meistertragödie niederdrückend, so die Kunst des Euripides oder etwa Ibsens Wildente. Sie verbannen uns aus jedem Reich der siegenden Gnade, aus dem Hain des Oidipus von Kolonos, in den Bannkreis willkürlicher und bösartiger Dämonen.
Unter Schaffenden und Kunstfreunden gibt es manche, die von der Mitempfindung des Traurigen so sehr überwältigt werden, daß sie der Tragik entsagen und sich gegen ihre ästhetische Wirkung sträuben. Wiederum gibt es unter den großen Meistern ausgeprägte Tragiker, wie Aischylos, Hebbel, Michelangelo, Beethoven.
Harmlose Lösung eines gespannten Interesses durch dessen herabstimmenden Umschlag in entgegengesetzte Richtung wirkt heiter komisch, wenn beide Glieder des Gegensatzes gleich selbständig sind. Der Gegensatz erscheint alsdann zufällig, aber doch nicht unmotiviert, als Zusammentreffen unvereinbarer Faktoren. Selbst wiederholter Betrachtung hält er stand, wenn die ursprüngliche Spannung einem wirklichen Werte galt. Sind dagegen die ästhetischen Anforderungen an den Zusammenhang der Gegensatzglieder und an das Interesse dafür nicht erfüllt und tritt an Stelle des vermeinten Wertes ein bloßer Unwert, so wirkt die entspringende Heiterkeit nicht einmal mehr witzig sondern nur noch läppisch oder abgeschmackt. Ereignet sich aber die komische Wirkung an einem sonst erhabenen oder gar tragisch anmutenden Gegenstand, so entsteht der edle Humor oder die Tragikomik. Ästhetisch wohlgefallender Kampf gegen Unwerte, geführt mit den Kunstmitteln der Komik, siegt durch Karikatur und Satire; ist seine Grundstimmung wohlverständliche Empörung, so kann sich die Satire bis zum Sarkasmus verschärfen.
Kant sah das Vergnügen an der Komik als animalische Heiterkeit an; ihm ist das Lachen ein Affekt, entspringend aus plötzlicher Verwandlung hochgespannter Erwartung in
Nichts. Hier ist eine Begleiterscheinung der ästhetischen Heiterkeit auf deren Kosten überschätzt. Schopenhauer führt das Lächerliche auf die paradoxe und daher unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff zurück, auf die plötzliche Wahrnehmung also der Inkongruenz zwischen dem Abstrakten und der Anschauung. Seine Erklärung ist viel zu weit. Paradoxa brauchen an sich gar nicht komisch zu wirken. Höchste Feinheit der Schmeichelei kann sich als größte Grobheit enthüllen. Nach Köstlin ist Komik überall, wo Ungereimtheit sich auflöst; ihm ist der heitere harmlose Widerspruch komisch, im Gegensatz zum ernsten zerstörenden, der ihn tragisch dünkt. Diese Auffassung ist viel zu logisierend, ebenso wie jene Kraepelins, der erklärt, komisch wirke ein unerwarteter intellektueller Kontrast, der in uns einen Widerstreit ästhetischer, ethischer und logischer Gefühle zu unserer Lust erwecke. Nach v. Hartmann ist fahrlässig verschuldete Unlogik komisch, die, uns zur Lust, ästhetische Genugtuung gewährt. Hier wird zu einseitig die Komik von Personen betont, ähnlich wie bei Groos, der die Grundlage der Komik in der Verkehrtheit sieht, die wir mit dem Gefühl innerer Überlegenheit betrachten. All diesen Überlegungen liegt zu ausschließlich das Problem der heiteren Komik, besonders des Witzes zugrunde. Der hohe Humor und die fast tragische Komik bei Aristophanes oder Moliere bleibt unberücksichtigt. Auf diese Fragen hat Hegel eine metaphysische Antwort zu geben gesucht. Überhorst verwechselt eine Art von Schadenfreude mit Komik, wenn er meint, daß schlechte Eigenschaften an einer Person uns belustigen, wenn wir uns dergleichen nicht bewußt sind und keine heftige moralische Unlust in uns aufsteigt. Volkelt betont auch das Überlegenheitsgefühl dessen, der sich an Komik freut; es ist dies aber nicht unbedingt erforderlich; auch sind es nicht nur Scheinwerte, die sich in Lachen auflösen. Humor vernichtet keinen Wert, wenn er auch über wertvolle Menschen lächelt. Zudem ist Volkelts Beschränkung auf die menschliche Sphäre eine zu enge Fassung.
Die Komik in der Natur läßt sich auf sie nicht einfach zurückführen.
Wenn wir das Wesen der komischen Modifikation bestimmen wollen, müssen wir von den gegenständlichen Grundlagen ausgehen, von der Besonderheit der herrschenden Objektgefühle. Sie sind allgemein als akute Heiterkeit zu umschreiben. So wirken Gegenstände, die zuerst lebhaftes Interesse spannen und bald lösen. Das ist auch bei heiteren Spielen und Neckereien nicht anders. Der Gegenstand ist eindringlich, aber die von ihm ausgehende Spannung erhält sich nicht, sondern sie spaltet sich und wird so entlastet. Die heitere Stimmung entzündet sich leicht an harmlosen Kontrasten; wenn tiefe, einschneidende, ernsthafte Interessen verletzt werden, entspringt keine leichte Heiterkeit. Die Spaltung und Entspannung des Interesses ist näher Herabstimmung. Einheit des Gegenstandes, gegensätzliche Richtung gespaltenen Interesses, Auflösung des Interesses ohne tiefe Verletzung, Werterniedrigung des Gegenstandes müssen zu komischer Wirkung zusammenstimmen. Wer sich mit Recht verletzt fühlt, versteht keinen Spaß. Wenn die erheiternde Wirkung in Komik übergehen soll, so muß nicht nur ästhetisches Verhalten vorausgesetzt werden, sondern auch eine ästhetisch befriedigende Qualität des Gegenstandes. Der ursprüngliche fesselnde Wert darf sich nur in der niederen Komik als ein Scheinwert enthüllen; in der edleren Komik muß er trotz einiger Herabstimmung unzerstört standhalten. Ein Knabe, der mit Vaters Zylinder stolziert, bringt uns zum Lachen, wird aber durch das angemaßte Zeichen der Würde nicht moralisch entwertet und verliert auch unsere Sympathie nicht. Wäre das Kind aber blödsinnig, so würde nur der gemeine Mensch über das sonst so heitere Bild lachen.
Daß uns Komik gefällt, hat seinen Grund nicht im Lachen. Das Lachen drückt nur aus, daß uns etwas erheitert. Es ist offenbar falsch, die tragische Stimmung mit Weinerlichkeit, das Komische mit dem Lächerlichen zu identifizieren. Hegel hat das mit Recht bekämpft. Es lacht auch, wer ge-
kitzelt wird, wer bitter und verächtlich gestimmt ist. Oft fühlen wir uns komisch berührt und lachen doch nicht. Humor und edle Komik verführen nicht zu schallendem Geprust, sondern höchstens zu leisem Lächeln. Laut gelacht wird nur bei drastischer Komik. Wie die Tragik so hat auch die Komik noch mancherlei Spielarten. Mit Volkelt unterscheidet man objektive und subjektive, freiwillige und unfreiwillige Komik; ferner spricht man von Situationskomik und Charakterkomik. Objektive Komik wird vorgefunden, die subjektive wird gemacht. Man macht Witze. Ausgezeichnet ist vor allem das Gebiet des Humors. Humor kann Komik auch an erhabenem Gegenstand finden. Große Humoristen wie Dickens erheitern nicht nur, sie erheben auch. Der Träger humoristischer Mängel ist oft zugleich bedeutend; sittliche Größe in komischer Hülle rührt uns. Ist der komisch belastete Mensch zugleich tragische Gestalt, so erschüttert uns sein Zwiespalt trotz leisen Lächelns. Cyrano de Bergerac ist tragikomisch. Großen Dichtern wie Hebbel erschien die Tragikomik als höchste ästhetische Modifikation. Nirgend so wie im Lachen verrät sich, wie fein und durchgebildet eines Menschen ästhetisches Verhalten ist. Die Meisterschaft des Humors erwirbt nur, wer zur Selbstironie überlegen genug ist.
Wer sich nicht selbst zum besten haben kann, der ist gewiß nicht von den Besten.
Goethe.
Literatur:
Volkelt, Ästhetik des Tragischen.
München
1897.
Lipps, Komik und Humor. Hamburg 1898.
Heymans, Ästhetische Untersuchungen. Zeitschrift
für
Psychologie, 1896, Bd. 11.
Überhorst,
Das Komische. 1896, Bd. 1, 1900, Bd. 2.
Seidl, Zur Geschichte des Erhabenheitsbegriffes seit Kant. 1889.
Jahn, Das
Problem des Komischen in seiner geschichtlichen Entwicklung.
Potsdam 1904.
Hollingworth,
Experim. Studies in Jugdment; Jugdments of the Comic. Psychol. Review,
Bd. 18, S. 132ff.
Martin,
Psychology of Aesthetics, Bd. 1. American Journal of PsychoJogy, Bd.
16.
Bergson, Le rire. Paris 1900.
Fechner, Vorschule der Ästhetik. Leipzig 1876.
Köstlin,
Ästhetik. Tübingen 1869.
v. Hartmann, Ästhetik. 2 Bde. Leipzig 1887.
Marshall,
Aesthetic principles. 1895.
Guyau,
Les problémes de l’esthétique
contemporaine. 4.
Aufl. 1897.
Groos,
Einleitung in die Ästhetik. Gießen 1892.
Lange,
Das Wesen der Kunst. 2 Bde, Berlin 1901.
Cohn, Allgemeine
Ästhetik. Leipzig 1901.
Lipps,
Ästhetik. 2 Bde. Hamburg 1903/06.
Witasek,
Grundzüge einer allgemeinen Ästhetik. Leipzig 1904.
Volkelt, System der Ästhetik. 3 Bde. München
1905/10/14.
Dessoir, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Stuttgart
1906.
– Zeitschrift für Ästhetik und
Kunstwissenschaft
(Bibliographie) seit 1906.
Christiansen,
Philosophie der Kunst. Hanau 1909. Croce, Estetica. 3. Aufl. Bari 1909.
Cohen,
Ästhetik des reinen Gefühls. 2 Bde. Berlin 1912.
Müller-Freienfels,
Psychologie der Kunst. 2 Bde. Leipzig 1912.
Meumann,
Einführung in die Ästhetik der Gegenwart. 2. Aufl.
Leipzig
1912.
– System der Ästhetik. Leipzig 1914.
Utitz, Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft.
Stuttgart 1914.
| Ablenkung 9. | Auslese 92. |
| Abschluß 140. | Ausschnitt 156. |
| Absicht, künstlerische 92. 162. | Auswahl 156. |
| Abstufung des Interesses 153. 156. | |
| Académie française 30. | Barock 171. |
| Achtung 168. 170. | Baukunst 19. |
| Adäquate Anschauung 80. | Beobachtung 54f. |
| Adäquate Erfüllung 61. | Bereitschaft 85. 87. |
| Ähnlichkeit 40. | Beschaffenheit, merkliche 8. 71. 151. |
| Akkord 134. 137. | Beschleunigung 146f. |
| Aktiver Faktor 72. | Beschränkung 15. 30. |
| Allgemeine Ästhetik 14. | Beseelung u. ä. 84. 102. |
| Amusisch 7. | Betrachtung, ästhetische 14. |
| Anachronismus 155. | Betrachtungsgenuß 116. |
| Analyse der Bedeutungen | Beurteilung 116. |
| Angenehm, Annehmlichkeit | Bewunderung 168. |
| Animismus 167. | Bewußtheit 70f. |
| Anmut 18. 28. 42. 166ff. | Bewußtseinslage 70. |
| Anschaulich, Anschaulichkeit 7. 68ff | Bewußtseinszustand 15. |
| Anthropomorphismus 97. 103. 167. | Bildschärfe 157. |
| Apodiktisch 119. | Brauchbarkeit 14. |
| Apperzeption, ästhetische 90. 95. | Bühnenauswirkung 126. |
| Apperzeption, beseelende 102. | Burleske 168. |
| Aristotelismus 27. | |
| Ars poetica 19. 27. 30. | Charakter 105. 129. |
| Assoziation 34f. 39. 44f. 99. | Charakterkomik 178. |
| Assoziativer Faktor 42. 45. 58. 72. | Crescendo 143. |
| 80. 91. 143. | |
| Ästhet 7. 12. 87. | Decrescendo 143. |
| Aufbau 156. | Deduktion, deduktiv 63. |
| Auffassung 117. | Deduktive Methode 60. |
| Ausdruck 13. 90. 96. 107. 157. | Degenerationsmerkmal 126. |
| Ausdrucksmethode 56. | De gustibus non est disputandum 2. 120. |
| Ausgang, tragischer 173. | Direkter Faktor 45. 72. 91. 150. 151. 154. |
| Dissonanz 134. | Erkenntnistheoretisch 79. |
| Dissoziation 125. | Ernstgefühl 108. |
| Distanz 102. | Ernsthaftes Interesse 177. |
| Drollig 172. | Erwartung 175. |
| Duft 14. | Erziehung, ästhetische u. ä. 4. 10. 123. |
| Dur 138. 141. | Ethnologische Methode 50. |
| Durakkord 137. | Experiment 55. |
| Experimentelle Ästhetik 44. | |
| Ebenmaß 13. 14. 20. 24. 34. | – Methoden 55. |
| Eigenwert 52. 117. | – Psychologie 44. |
| Eindruck 55. 84. 112. | |
| Eindrucksmethode 55. | Farbe 128. |
| Eindrucksurteil 119. | F arbencharakter 129. |
| Einengung 86. | Farbenharmonie 118. |
| Einfachheit 36. 160ff. | Farbenkombinatioo 129f. |
| Einfall 125. | Farbenreinheit 113. |
| Einförmigkeit 35. 41. | Feierlichkeit 172. |
| Einfühlung 80. 85. 94ff. | Feile, Feilung 19. 126. |
| – abstrakte 100. | Fernsinne 73. |
| – einfache 94. | Forderungscharakter 117. |
| – konkrete 100. | Form 25. |
| – negative 97. | Formalästhetik 164. |
| – positive 97. | Formalismus 26. |
| – symbolische 97. | Fragebogen 60f. |
| – sympathische 94. 99. 107. 170. | Freiheit des Künstlers 163. |
| Einfühlungstheorie 26. | Fremdwert 52. |
| Einheit 16. 33. 152. 154. | Fuge (a) 144. |
| – in der Mannigfaltigkeit u. ä. | Fülle 158ff. |
| 33. 41. 44. 45. 149. | Futurismus 81. |
| Einseitigkeit 81. | |
| Einsfühlung 97. 99. 106. | Ganzes 16. |
| Einstellung, ästhetische 85ff. | Gebärde 166ff. |
| Einzelwissenschaft 47. | Gedanken 69. 71. 86. |
| Element 41. | Gefallen 8. 110ff. 163. |
| Emotionaler Faktor 72. 89. | Gefühl 30. 34. 51. 74. 115. |
| Empfänglichkeit 1. 6. 34. 38. 122f. 124. | Gefühlscharakter 105. |
| Empfindungsqualität 128. | Gegensinnig 165. |
| Empörend 173. | Gegenspiel 174. |
| Entsetzlich 173f. | Gegenstand, ästhetischer 7. 11. 63. 67ff. 104. |
| Erhaben, Erhabenheit 6. 23. 30. 37. 41. 168ff. | Gegenstandsbewußtsein 63. 72. 83. |
| Erinnerungswissen 68. | Gegenstandsdurchbildung 91. |
| Gegenwart, ideale 39. | Hilfe, ästhetische 44. |
| Gehalt 18. 23. 74. | Historische Methode 60. |
| „Geltung“ der Töne 132. 143. | – Treue 83. |
| Gemütsbewegung 37. | Humor 175. |
| Genetische Methode 60. | |
| Genie 26. 31. 124ff. | Ideal u. ä. 9. 17. 102. 167. 170. |
| Genugtuung, ästhetische 176. | Ideales Objekt 62. |
| Genuß, ästhetischer 20. 115. | Idealwissenschaft 10. 12. 47. |
| Gerechtigkeit, ästhetische 109. | Idee (antik) 14. 19. 21. 22. 77. 173. |
| Geruch 73 (vgl. Duft). | – (englisch) 32. 34. |
| Geschmack 1. 33. 36. | Illusion 91. |
| Geschmacksurteil 4. 38. 40. 116. | Imagines 19. |
| 119. | Impressionismus 81. 162. |
| Geselligkeit 167. | Individualität 106f. |
| Geselligkeitstrieb 37. | Individualpsychologie 87. |
| Gestalt 25. 31. | Individuelle Unterschiede 112. |
| Gestaltlos 21. | Induktion, induktiv 54. 63. |
| Gestaltwahrnehmung 150. | Innigkeit 104. |
| Gewöhnung 45. | Inspiration 14. 19. 124. |
| Glanz, glänzend 14. 34. 37. 41. 45. | Institutio oratoria 19. |
| Gleichheit 34. | Intellektueller Faktor 89. 124. |
| Gleichsinnig 165. | Interesse 7. 92. 151 ff. 177. |
| Goldener Schnitt 130. | Interessenabstufung 153. 156. |
| Grade der Empfänglichkeit 1. | Interpretation 93. |
| Grauen 170ff. | Intervall 131. 134f. |
| Grenzen der Individualität u. ä. 106f. | Intuition 64. |
| Größe 23. 41. 168ff. 173. | Irrealität 72. |
| Grundbedürfnis 51. | |
| Grundton (Farbe) 130. | Kanon, kanonisch 13. 28. |
| Karikatur 175. | |
| Harmonie (ästhetische), harmonisch | Katharsis 17. 113. |
| 19. 33. 40. 113. | Klangfarbe 135f. 141. |
| – metaphysische 13. 21. | Klangverwandtschaft 137. |
| – (musikalische), harmonisch 21. | Klarheit 25. 30. 44. 156ff. |
| Harmonielehre 18. | Klassisch 115. |
| Häßlichkeit 163. 166. | Klassizismus 30. |
| Hauptthema 153. | Kleinkunst 172. |
| Heiterkeit 175. 177. | Komik, komisch 175ff. |
| Held, tragischer 174. | Kommentar 118. |
| Helldunkel 118, 157. | Komödie 16. |
| Herabstimmung 177. | Komplementärfarben 129f. |
| Herstellungsmethode 56. | Konsonanz 133f. |
| Kontaktsinne 73. | Motivierung 174. |
| Kontemplation, ästhetische 8. 81. 84. | Musik 132ff. |
| 89ff. 104. 170. | Musiktheorie 18. |
| Kontrast 45. 156. 157. 163. 177. | |
| Konzentration, ästhetische 98. | Nachahmung 15. 20. 96. 98. 161. |
| Kritik 19. 38. 51. | – der Natur 30. 31. 83. |
| Kultur, ästhetische 50. | Nachbildung 16. |
| Kunst ti. | Natur 30. 41. 79. 157. |
| Kunstart 13. 16. | Naturalismus 81. 157. 161. |
| Kunstgeschichte 60. | Naturgemälde 156. |
| Kunstlehre 17. | Natürlichkeit 160ff. |
| Kunsttheorie 12. 18. 27. | Naturphotogramm 156. |
| Kunstwerk 52. 58. | Nebenwerte 57. |
| Norm 2. 10. 50. 51. | |
| Lachen 175. 177. | Normative Ästhetik 10. |
| Laokoon 161. | Normwissenschaft 48. |
| Läppisch 175. | Notwendigkeit 173f. |
| Legato 143. | |
| Leibhaftige Bewußtheit 71. | Oberton 135. |
| Linie, große 118. | Objektive Ästhetik 50. |
| Lösung 173. | Objektsgefühle 164ff. 177. |
| Lust, ästhetische 112. | Oktave 133. |
| Ordnung 24. 41. | |
| Mannigfaltigkeit 36 (vgl. Einheit | Organempfindungen 102. |
| in der M.). | |
| Manierismus 155. | Paradox 176. |
| Maßeinheit 19. | Pathos 23. |
| Materie 22. 25. | Pause 144. |
| Material 93. | Pensieroso 106. |
| Materialechtheit 14. | Personifikation 100. |
| Menuett 168. | Persönlichkeit 33. |
| Merkliche Beschaffenheit 8. 71. | Perspektive 28. |
| 151. | Phänomenologie, phänomenologisch 47. 48. |
| Metaphysik, metaphysisch 43. 47. 52. | Phänomenologische Methode 61ff. |
| Mimesis 16. 29. | Phantasie 19. 28. 32. 42. 124. |
| Mißfallen 8. 110ff. 163. | Phantasiegefühl 108. |
| Miterleben 96. 99. 113. 154. | Phasen 58. |
| Modifikationen, ästhetische 111. | Philosophie 47. |
| 163ff. | Phrasierung 147. |
| Moll 138. 141. | Plein-air 162. |
| Mollakkord 137. | Plumpheit 168. |
| Motiv 141. | Poetik 17. 27. 29. |
| Pracht 172. | Schaffenskraft 4. |
| Prinzipien 2. 44f. 52. 121. 128ff. | Schein 15. 77. 81. 84. |
| 151ff. | Scheingefühl 77ff. 81. |
| Produktion, produktiv 76. 123ff. | Schnitt, goldener 130. |
| Programmusik 161. | Schlußakkord 142. |
| Projektion 97. | Schönheit 6. 24. 34. 52f. 163. 169. |
| Proportion, Proportionalität 14. 19. | – geistige 14. 15. 20. 22. |
| 28. 34. 113. | Schuld, tragische 174. |
| Prüfung 116ff. | Schwebung 131. |
| Prunk 172. | Schwelle, ästhetische 44. |
| Pseudochromästhesie 91. | Schwulst 23. |
| Psychologie 12. 47. 48. 49. | Seele 22. |
| Psychologische Analyse 26. 32. 49. | Sekundäre Qualitäten 32. 41. 119. |
| – Ästhetik 50. | Selbstbeobachtung 58. |
| Selbsterhaltungstrieb 37. | |
| Rahmen 152. | Selbstgefühl 170. |
| Rangordnung der Künste 28. | Selbstironie 178. |
| Rapport (nach Diderot) 31. | Sfumato 118. 157. |
| Raumverhältnisse 130. | Sieg des Wertes 174. |
| Reaktionsgefühl 110. | Sinne 14. 38. 73. 75. 157. |
| Realisierung, psychologische 48. | Sinnliche Größe 170. |
| Realismus, transzendentaler 77. | Sinnliches Ideal 167. |
| Realität 72. | Situationskomik 178. |
| Rede 32. | Spezielle Ästhetik 18. |
| Regelmäßigkeit 155. | Spiel 15. 125. 174. |
| Reihenmethode 55ff. | Spielraum für individuelle Neigungen 118. |
| Reiz 76. | Staccato 143. |
| Relativer Faktor 72. 80. 150. 154. | Stärke 141f. |
| Renaissance 27. | Stil 17. |
| Reprise 146. | Stilart 118. |
| Reproduktion, reproduzieren 32. | Stimmungseinfühlung 94. 105. |
| 42. 95. | Stimmungsfärbung 165. |
| Rezitativ 146. | Stimmungsgehalt 138. |
| Rhythmik 18. | Stoffwahl 125. |
| Rhythmus 131.139. 147. 149. | Subjektivismus 2. |
| Rigorismus 15. | Sühne 174. |
| Rubato 146. | Symbol 69. 101. 104. |
| Rührung 111. | Symbolischer Faktor 72. |
| Symbolismus 81. | |
| Sammeln von Beobachtungen 55. | Symmetrie, symmetrisch 14. 15. |
| Sarkasmus 175. | 19. 20. 113. 145. |
| Satire 175. | Synästhesie, ästhetische 75. |
| Takt 148. | Variation, variabel 55f. 59. |
| Tasteindruck 128. Verachtung 170. | Verehrung 168. 170. |
| Technik t. 11. 13. 28. 81. 115. | Vergegenwärtigung (psychische) |
| Thema (musikalisches) 145. | 102. |
| Teilnahme 81. 113. 154. | Vergeltung 174. |
| Teilnahmegefühl 110ff. | Vergleichung 55. |
| Tempo 145ff. 155. | Vergleichende Methoden 57. 59. |
| Teleologischer Faktor 72. | Verhalten, ästhetisches 4. 9. 11. 48. |
| Tertiäre Qualitäten 119. | 50. 52. 53. 71. 113. |
| Tiefe 158ff. | Verhältnisse, edle 24. (vgl. |
| Ton 128. | Proportion). |
| Tonhöhe 13. 132. | Verhältnismäßigkeit 41. |
| Tonika 140. | Verlangsamung 146. |
| Tonleiter 133. 141. | Vernunft 30. |
| Tonsystem 133. | Verschmelzung 134 ff. |
| Totalreaktion 112. | Versöhnend 174. |
| Tragik, tragisch 172ff. | Verständigung 117. |
| Tragikomik, tragikomisch 175. 178. | Verständnis 90. 93. 96. 113. |
| Tragödie 16. | Verständnisurteil 118. |
| Transponieren 132. | Verstimmung 135. |
| Triumphierende Idee 173. | Versuchsperson 55. |
| Tücke des Objekts 160. | Verzeichnung 79. |
| Virtuosität 125. | |
| Überlegenheit 176. | Vokale 136. |
| Übersichtlichkeit 15. 16. | Vollkommenheit 13. 25. |
| übung 45. | Vorbild 123. |
| Unanschaulich 68ff. | Vorstellung 76. 103. |
| Unbewußter Faktor 124. | |
| Unfreiwillige Komik 178. | Wahl 36. 55. 57. |
| Ungeheuer (groß) 15. 170. 172. | Wahnsinn 126. |
| Ungeteilte Beschäftigung 8. | Wahrheit 30. 44. 155. |
| Ungemein (groß) 169. | Weihevoll 172. |
| Ungereimtheit 176. | Wert, ästhetischer 4. 52f. 108. |
| Universalität 81. 86. | 114. 116. 168ff. |
| Universalgenie 124. | – außerästhetischer 108. |
| Unlust, ästhetische 112. | Wertästhetik 12. |
| Unmittelbarkeit 69. | Wertausgleichung 162f. |
| Unterhaltung 52. | Werterniedrigung 177. |
| Unterschiedsempfindlichkeit 133. | Wertgefühl 110f. 165. |
| Unwert 169ff. | Wertmaßstab 116f. |
| Urteil, ästhetisches 7. 11. 116. 117. | Wertschätzung 39. |
| Ut pictura poesis 19. 29. 71. 161. | Wertübertragung 42. 162f. |
| Wertung 116ff. | Wissen 68. |
| Werturteil 17. 51. 121. | Witz 175ff. |
| Wertwissenschaft 50. 53. | Wohlgeordnetheit 15. |
| Wesensgesetzlichkeit 64. | Würde, würdevoll 18. 42. 172. |
| Wesentliches Schicksal 17. | |
| Wiederholung 37. 145. 156. 158. | Zeitvariation 56f. 99. |
| Widerschein 25. | Zeitverhältnisse 130. |
| Widerspruch (ästhetischer) 154. | Zierlich 172. |
| 176. | Zusammengehörigkeit 154ff. |
| Winzig, Winzigkeit 15. 169. 172. | Zusammenhang 26. |
| Wirkung, ästhetische 54. 58. 73. 79. | Zusammenstimmung 20. |
| 92. 100. 113. 117. 121. 128ff. | Zustand, ästhetischer 11. 83ff. |
| Wirkungsakzent 105. | Zweckmäßigkeit 14. 18. 36. |
| Ach 70. | Conrad 62f. |
| Addison 32. | Correggio 153. 155. 167. |
| Aischylos 175. | Cornefius 50. |
| Alberti 27. | |
| Alison 42f. | Demokritos 13. |
| v. Allesch 80. | Descartes 30. |
| Andrea de) Sarto 168. | Dickens 178. |
| Apollonios von Tyana 19. | Diderot 31. |
| Aristides Quintilianus 18. | Dilthey 38. 60. |
| Aristophanes 176. | Dionysios von Halikarnass 18. |
| Aristoteles 15ff. 27. 30. 112. 113. | Dolce, Lodovico 28. |
| 173. | Dubos 30. |
| Aristoxenos 18. | Dürer 28. 168. |
| Augustinus 24. | Dyroff 13. |
| Baker 56. 128f. | Eichendorff 168. |
| Batteux 31. | Euripides 175. |
| Beethoven 101. 106. 115. 138. 139. | |
| 149. 175. | Fechner 43ff. 54ff. 72. 134. 158. |
| Böcklin 118. 158. | 162. |
| Boileau 29. 30. | Feuerbach 118. |
| Bolton 130. | Flavius Philostratus 19. |
| Bouhours 30. | Francia 153. |
| Botticelli 153. 167. | |
| Brahms 138. 141. | Gebhardt 155. |
| Bray 73f. | Geiger 63f. 97. 105. 106. 115. |
| Bühler 150. | Goethe 21. 115. 125. 178. |
| Bullough 106. | Gmos 74. 77. 80. 96. 113. 115. 176. |
| Burke 36f. 171. | Grosse 50. 60. |
| Gozzoli 153. | |
| Calkins, Mary 54 f. | |
| Catalani 172. | Hals, Frans 105. |
| Cennini 27. | v. Hartmann 73. 77 ff. 166. 173. |
| Cicero 18. 27. | 176. |
| Cohn 56. 68f. 116. 128f. | Hauptmann 154. 155. |
| Haydn 142. | Michelangelo (Buonarotti) 106. 115. |
| Hebbel 114. 160. 171. 172. 174f. 178. | 156. 175. |
| Hegel 23. 43. 73. 169. 176. 177. | Moliere 176. |
| Herder 96. | Mozart 168. |
| Hogarth 36. · | Murillo 153. |
| Horne 38ff. 45. 167. | |
| Horaz 19. 27. 29. 30. 71. | Novalis 96. |
| Hume 32. 36. 38. | |
| Husserl 48. | Opitz 29. |
| Hutcheson 33f. 41. | |
| Platon 14f. 30. | |
| Ibsen 175. | Plotinos 20ff. 33. |
| Potter 157. | |
| Jaspers 71. | Preyer 128. |
| Jean Paul (Richter) 96. | Proklos 23. |
| Pythagoras 13. | |
| Kästner 129. 131f. | |
| Kant 38. 43. 68. 113. 160. 169. 175. | Quintilian 19. 27. |
| Krueger 131. | |
| Köstlin 169. 176. | Raffael (Sanzio) 104. 155. 156. 167. |
| Kraepelin 176. | Rembrandt 118. |
| Reni, Guido 168. | |
| Lalo 73. | Ribot 74. 124f. |
| Lange 77. 84. | Ritook 91. 92. |
| Leibniz 26. | Rossini 168. |
| Lenbach 153. | Rubens 168. |
| Lessing 28. 38. 40. 161. 167. | Ruysdael 156. |
| Lichtwark 92. | |
| Liebmann 73. | Scaliger 29. |
| Lionardo (da Vinci) 28. 118. 157. | Schelling 23. 43. 173. |
| Lipps 94ff. 113. 173. | Schiller 43. 51. 166. 167. |
| Locke 32. 119. | Schlegel, August Wilhelm 96. |
| Longin 23. 29. | Schopenhauer 43. 169. 176. |
| Löwe 59. | Schubert 59. |
| Lotze 96. | Schultze 105. |
| Segal 49. 56. | |
| Major 56. 128. | Segantini 115. |
| Malherbe 30. | Shaftesbury 32f. |
| Marbe 70. | Shakespeare 33. 115. 155. 171. |
| Martin, Lillien 56. 75. 91. | Sokrates 14. 173. |
| Meumann 50. 99. | Stern 99. |
| Meyer 68. | Stumpf 131. |
| Taine 31. 60. | Volkelt 51. 69. 74. 97. 110f. 167ff. |
| Terenz 110. | 176. 178. |
| Thomas von Aquino 25. | Volkmann 50. 59. |
| Tizian (Vecellio) 153. | |
| Waetzold 50. | |
| Überhorst 176. | Wagner 115. 141. 143. 155. 158. |
| 172. | |
| Vaihinger 108. | Wallaschek 146. |
| Vasari 28. | Watteau 168. |
| Vergil 29. 161. | Witmer 56. |
| Vida 29. | Wundt 50. 74. 137. |
| Vischer, Friedrich Theodor 96. 160. | |
| – Robert 96. | Xenophon 14. |
| Vitruv 19. 27. | |
| Voll 50. | Zelter 59. |
(Auszug aus der bibliographischen Zusammenstellung von Clemens Baeumker und Karl Bühler im Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München, 1916.)
Außerdem ist zu nennen die Schrift: Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. Philosophische Abhandlungen, Max Heinze zum 70. Geburtstage gewidmet. Berlin 1906.